Ein Gastbeitrag von Matthias Hueber
 Radfahrstreifen oder Schutzstreifen sind sehr beliebt in Deutschland. Seit der Gesetzesnovelle der StVO im Jahr 1997 dürfen Radfahrstreifen auch in stärker belasteten Verkehrsbereichen angelegt werden und gleichzeitig wurde die bei vielen Radfahrern verhasste Benutzungspflicht aus dem Jahr 1935 endlich auf den Prüfstand gestellt. Eine an sich erfreuliche Neuerung aus Radfahrersicht, möchte man annehmen, da einerseits Kommunen nun die Möglichkeit haben, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und geringem Kostenaufwand die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Andererseits, weil sie nun auch dazu angehalten werden, die oft willkürlich (erscheinenden) Benutzungspflichten aufzuheben und das Radfahren auf der Straße zuzulassen, wo die Umstände es erlauben.
Radfahrstreifen oder Schutzstreifen sind sehr beliebt in Deutschland. Seit der Gesetzesnovelle der StVO im Jahr 1997 dürfen Radfahrstreifen auch in stärker belasteten Verkehrsbereichen angelegt werden und gleichzeitig wurde die bei vielen Radfahrern verhasste Benutzungspflicht aus dem Jahr 1935 endlich auf den Prüfstand gestellt. Eine an sich erfreuliche Neuerung aus Radfahrersicht, möchte man annehmen, da einerseits Kommunen nun die Möglichkeit haben, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und geringem Kostenaufwand die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Andererseits, weil sie nun auch dazu angehalten werden, die oft willkürlich (erscheinenden) Benutzungspflichten aufzuheben und das Radfahren auf der Straße zuzulassen, wo die Umstände es erlauben.
Viele vor allem nationale Studien zu diesem Thema scheinen überdies die Sicherheit von Radfahrstreifen gegenüber baulich getrennten Radwegen zu bestätigen. So kommt zum Beispiel Angenendt 1993 (BASt-Studie V9) zu dem Ergebnis, dass auf Radwegen die so genannte Unfallrate einen Wert von 5,1 erreicht (bzw. 8,9 berücksichtigt man das Unfallrisiko an Kreuzungen mit). Die Studie kommt also scheinbar folgerichtig zu dem Ergebnis, dass das Unfallrisiko auf Radspuren wesentlich geringer anzunehmen ist – mit 5,7 Unfällen je Million gefahrener Kilometer mit dem Rad. Sie ignoriert aber den ganz wesentlichen Umstand, dass bauliche Radwege vor allem dort angelegt wurden, wo auch die Kfz-Verkehrsstärken sehr viel höher sind als dort, wo typischerweise Radspuren angelegt werden.
Zusätzlich spielt – wie die Studie von Angenendt schon nahelegt – auch das Kreuzungsdesign eine ganz wesentliche Rolle für das Unfallgeschehen. Denn Radfahrer werden schlechter wahrgenommen, wenn sie aus dem Blickfeld der Autofahrer gerückt werden. Diese Binsenweisheit – unisono sowohl von ehrenamtlichen als auch berufsmäßigen Radfahrexperten mantramäßig seit über zwanzig Jahren mit Rückendeckung der BASt-Veröffentlichungen und anderer Studienergebnisse vorgetragen – taugt auch heute noch als beliebtes Argument für die bevorzugte Anlage von Radspuren – neuerdings auch in hoch verkehrsbelasteten Bereichen deutscher Städte. Bezug genommen wird dabei in den meisten Fällen auf die markant höhere Unfalldichte von Radwegeanlagen – also die (absolute) Anzahl der Unfälle je Kilometer und Jahr.
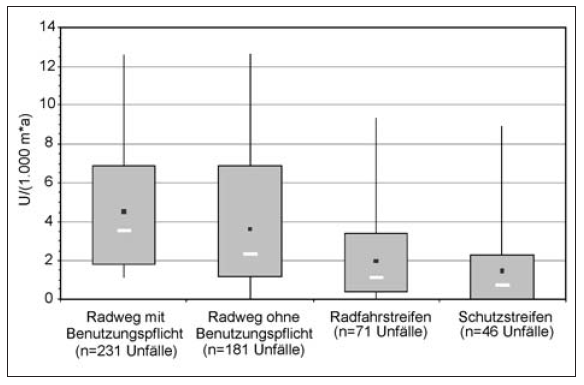
Bei genauer Betrachtung erweist sich aber genau diese Sichtweise als möglicherweise für Radfahrende fataler Irrtum in der jüngeren Geschichte der Radwegeplanung. Überall dort nämlich, wo baulich separiert wird – in den Niederlanden etwa und in Dänemark – dort wo man also statt Radspuren großzügige Radwege als Best-Practice-Lösung in Kfz-verkehrsbelasteten Straßen umsetzt, sinkt die Unfallquote zum Teil deutlich unter die der deutschen, wo in den vergangenen zwanzig Jahren, Radspuren als Allheilmittel gegen Radfahrunfälle und als Lösung innerstädtischer Verkehrsprobleme gelobpreist werden.
Nicht so die Studie „Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern“ der Bundesanstalt für Straßenwesen, kurz BASt, zu diesem Thema. Untersucht wurden die Unfallzahlen von 102 Straßen mit 193 Radwege-Abschnitten (mit und ohne Benutzungspflicht), Radfahrstreifen und Schutzstreifen in Köln, Berlin, Hannover, Halle, Fürth, Nürnberg, Bonn und Troisdorf. Sie gibt keine eindeutige Empfehlung für einen bestimmten Radwegetyp ab, sondern weist richtigerweise darauf hin, dass vor allem die standardkonforme Gestaltung das entscheidende Kriterium für erhöhte Radwegesicherheit ist. Sie weist aber auch einmal mehr darauf hin, dass Radwege im Vergleich zu Radspuren eine höhere Unfalldichte aufweisen und ignoriert dabei ganz entscheidende Fakten, die zugunsten einer (konsequenten) baulichen Separation sprechen könnten:
1. Die Kfz-Verkehrsbelastung an baulichen Radwegen ist meist besonders hoch
Radwege wurden bis zur besagten Gesetzesnovelle 1997 qua Gesetz vor allem in verkehrsstarken Straßenabschnitten ab 18.000 Kfz/Tag angelegt. Trotzdem werden in der Untersuchung der BASt die Unfalldichten von Radspuren und Radwegen in gleicher Weise miteinander verglichen, ohne aber bei der Bewertung näher darauf einzugehen, dass natürlich bei höheren Verkehrsstärken auch entsprechend höhere Unfallzahlen zu erwarten sind. Gleichwohl weisen die Autoren darauf hin, dass es einen Unterschied gibt, bei der Verkehrsstärke der untersuchten Radwege:
Die meisten benutzungspflichtigen Radwege liegen in den Verkehrsstärkeklassen von 20-25.000 sowie von über 30.000 Kfz/Tag. Die nicht benutzungspflichtigen Radwege liegen eher in Straßen mit niedrigeren Kfz-Verkehrsstärken, einige Anlagen jedoch auch in Straßen mit über 30.000 Kfz/Tag. Auch die Radfahrstreifen und die Schutzstreifen liegen in – gegenüber den benutzungspflichtigen Radwegen – zumeist schwächer belasteten Straßen. Einige markierte Anlagen liegen jedoch auch in Straßen, deren Verkehrsstärke mit mehr als 25.000 Kfz/Tag die Regeleinsatzbereiche der VwVStVO deutlich übersteigen.
Die Nachfolgende Grafik macht diesen Zusammenhang deutlich.
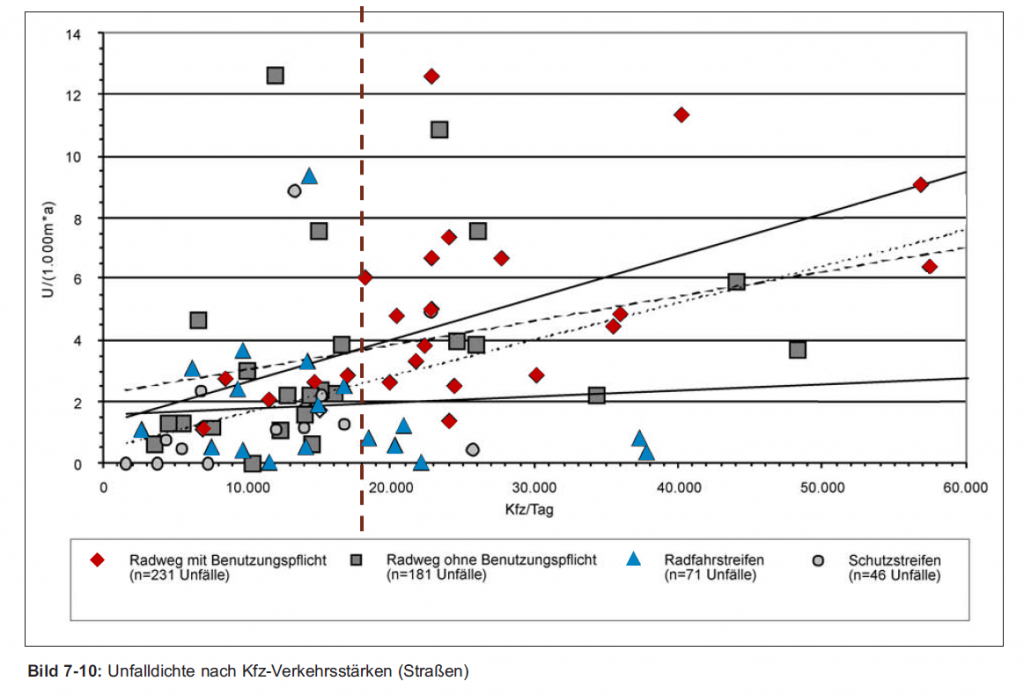
Die blau markierten Radfahrstreifen kommen ganz offensichtlich zumeist in Bereichen mit Kfz-Verkehrsstärken zwischen 2.000 und 18.000 Kfz/Tag vor. Die sechs weiter rechts der gestrichelten vertikalen Linie vorkommenden Radfahrstreifen sind nach den Standards der ERA 95 angelegt worden und befinden sich bis auf zwei Ausnahmen deutlich im Bereich bis 23.000 Kfz. Die (braun) gestrichelte Linie symbolisiert die bis 1997 geltende Kfz-Verkehrsbelastungsgrenze für Radfahrstreifen. Rot markiert sind die benutzungspflichtigen Radwegeanlagen, die gehäuft im Bereich ab 18.000 Kfz/Tag vorkommen.
Anders ausgedrückt: Radwege und Radfahrstreifen unterscheiden sich einerseits hinsichtlich ihrer Unfalldichte in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke nicht markant, was folgerichtig Empfehlungen zugunsten des einen oder anderen Radwegetyps verbietet, anderererseits ist es praktisch aber nun mal so, dass der bei hoher Kfz-Verkehrsstärke typische Anlagentyp der – meist viel zu schmale und mittlerweile sehr oft baufällige – benutzungspflichtige Radweg ist UND NICHT ETWA der ERA-konforme Radfahrstreifen mit nahezu perfekten Sichtbeziehungen und 1A-Bodenbeschaffenheit.
Auch Rad- und Fußverkehrsstärke variiert stark zugunsten von Radfahrstreifen
Ein weiterer potentiell stark verzerrender Aspekt bei der Beurteilung der Unfalldichte ist neben der Kfz-Verkehrsstärke einerseits die – missbräuchliche – Benutzung durch Fußgänger und die regelgerechte Nutzung durch Radfahrende selbst. Letztere ist auf benutzungspflichtigen Radwegen fast doppelt so hoch wie auf Radfahrstreifen. Die Schlussfolgerung, dass entsprechend mehr Unfälle auf benutzungspflichtigen Radwegen zu erwarten sind liegt nahe, wird aber im absoluten Wert „Unfälle je km und Jahr“ ebenso nicht gewürdigt.
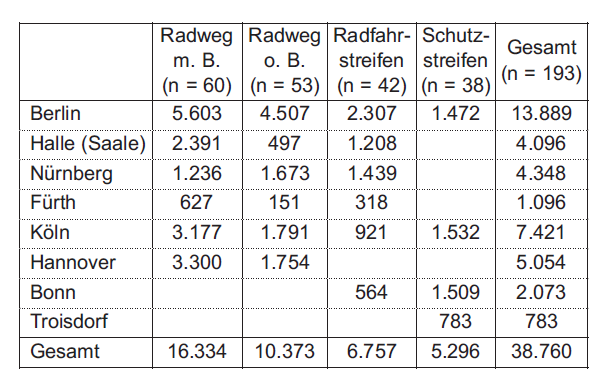
2. Bauliche Radwege sind nur so gut wie ihre Kreuzungen und Einfahrten
Viele vor allem schwere Unfälle an und auf Radwegen passieren an Kreuzungen mit dem KFZ-Verkehr. Zu diesem Ergebnis sind schon 1985 die Autoren der Studie „Cyclestier i byer – den sikkerhedsmæssige effekt“ Bach, Rosbach und Jørgensen gekommen. In Ihrer Untersuchung wurden über einen Zeitraum von drei Jahren die Unfallzahlen an Streckenabschnitten vor und nach Anlage eines Radweges untersucht, wo vorher zumeist gar keine Radinfrastruktur vorhanden war. Dennoch dient auch heute noch diese Untersuchung vielfach als Argument für die bevorzugte Anlage von Radfahrstreifen.
Man sieht zwar auf den ersten Blick deutlich, dass die Unfallzahlen mit Kfz- und Radfahrerbeteiligung an Kreuzungen deutlich (fast 50%!) zunehmen. Auf den zweiten Blick sieht man aber ebenso deutlich, dass sie an der Strecke selber um fast 35% abnehmen. Für die leichte Zunahme der Radfahrer-Unfälle an Streckenabschnitten ist zudem nicht (alleine) der untersuchte Radweg an sich selbst verantwortlich, sondern wie man an der Steigerung der Unfallzahlen der „Fußgänger mit Anderen“ ableiten kann, offensichtlich die wohl mangelhafte und viel zu schmale Anlage der Radwege auf Kosten der zu Fuß gehenden an den untersuchten Streckenabschnitten, ohne angemessene Separation der sehr heterogenen Verkehrsarten.
Im Grunde genommen, sagt also diese Studie aus einer Zeit der – vor allem autogerechten baulichen – Separation nichts weiter aus, als dass es äußerst gefährlich ist, Radwege anzulegen und dabei die neuralgischen Kreuzungspunkte bzw. die saubere Trennung auch zwischen Fußgängern und Radfahrern außer Acht zu lassen.
Lösungen für ein sicheres Kreuzungsdesign gibt es mittlerweile genügend in den Niederlanden. Dort setzt man auch innerstädtisch zum besseren Verkehrsfluss zunehmend auf ampelfreie Lösungen wie Unter- oder Überführungen oder Kreisverkehre. Dort wo man um Kreuzungen nicht herumkommt, kann man durch Optimierung der Lichtsignalanlagen und durch kleine bauliche Verbesserungen – wie im 2014 von Nick Falbo weiterentwickelten niederländischen Kreuzungsdesign – die Gefährlichkeit der Kreuzungsanlagen auf nahe null reduzieren.
3. Radwege werden vor allem von unsicheren Radfahren benutzt
Kinder mit oder ohne ihre Eltern, Senioren, Fahranfänger, Wiedereinsteiger, sie alle meiden die Nähe zu Kfz während man auf Radspuren bevorzugt erfahrene, reaktionsschnelle, sportliche und risikofreudige Radfahrer findet. Die untenstehende Abbildung zeigt auch, dass genau diese Gruppe zwischen 25 und 65 Jahren mit einer Unfallrate von 9,0 zu der am wenigsten unfallgefährdeten Gruppe gehört und wegen ihrer sicheren Fahrweise eher auf der Straße und auf Radstreifen anzutreffen ist. Andersherum: Diejenigen, die von einer gut ausgebauten Radinfrastruktur NEBEN der Straße nach etwa holländischem Vorbild am meisten profitieren würden, sind – wenig überraschend – genau diejenigen, die nach Aufhebung der Benutzungspflicht an einem baulichen Radweg eben jenen in aller Regel trotzdem lieber – oder im Fall der bis zu Achtjährigen zwangsweise – benutzen und leider auch diejenigen, die nolens volens durch ihr unsicheres Fahrverhalten und durch die wenig differenzierte Auswertungsformel der Unfalldichte nach BASt-Kriterien diesen als wesentlich unfallträchtiger erscheinen lassen, als er bauartbedingt eigentlich ist.
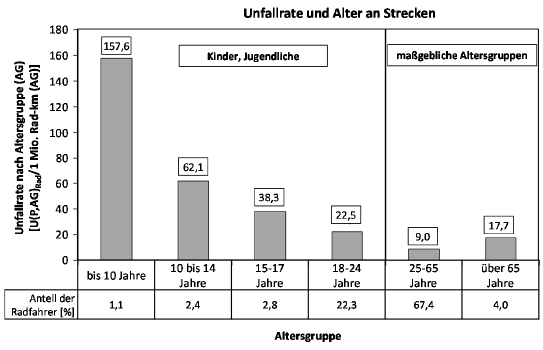
Der Unfalldichte-Wert von Radspuren sähe wohl deutlich schlechter aus, würde man die unfallsensiblen Alterskohorten dazu nötigen, statt auf dem für sie sichereren Radweg auf der Straße zu fahren. Denn, auch das ist eine Erkenntnis der zitierten BASt-Studie: die Anzahl der Konfliktsituationen, z.B. durch sich öffnende Türen oder parkende PKW, ist auf Radwegen um einiges geringer als auf Radfahrstreifen oder Schutzstreifen.
4. Radwege und Radspuren stammen aus völligen unterschiedlichen Epochen
Wenn Radwege mit Radspuren verglichen werden, so stehen auch immer wieder ganz unterschiedliche Qualitätsansprüche und verkehrspolitische Konzepte gegenüber. Radwege wurden häufig vor dem Hintergrund der autogerechten Stadtplanung und bis 1982 nahezu ohne vernünftige oder gar verbindliche Normen angelegt.
„1961 wurde der Radverkehrsausschuß der FGS dem Fußgängerverkehr zugeschlagen. Für die Radwegeplanung wurde das unbehinderte Fahren der Autofahrer zum Ziel. Beseitigt werden sollten z.B. die durch Radfahrer verursachten ‚Störungen‘ an Knotenpunkten (Ergebnis: Vorläufige Richtlinien für Radverkehrsanlagen“ von 1963). 1982, als die Renaißance des Radverkehrs unübersehbar wurde, veröffentlichte der Ausschuß die relativ unverbindlichen „Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen“, bei denen die Radnetzplanung und die Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel wieder stärker betont wurden.“ [Burkhard Horn: Vom Niedergang eines Massenverkehrsmittels – Zur Geschichte der städtischen Radverkehrsplanung]
Radspuren sind auf der anderen Seite erst seit den Neunziger Jahren bei Stadtplanern und AktivistInnen wieder vor allem durch die oben genannte StVO-Novelle von 1997 „En Vogue“ und werden seither mit großzügigen Regelbreiten und Abständen vor dem Hintergrund einer fahrradgerechteren Stadtplanung ausgestattet. Weitere unfallbeeinflussende Faktoren wie die in den allermeisten Fällen deutlich bessere Sichtbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden sich außerdem erheblich zwischen Radwegen und Radspuren. (Radwege mit (altersbedingt) schlechter Oberflächenbeschaffenheit führen häufig dazu, dass Radfahrende sich mehr auf den Oberflächenbelag und weniger auf das Gesamtverkehrsgeschehn konzentrieren. Siehe hierzu „The implications of low quality bicycle paths on gaze behavior of cyclists: A field test“, Pieter Vansteenkiste, et al, 2014)
Wenn trotzdem immer wieder beide Radanlagetypen miteinander undifferenziert verglichen werden und im Ergebnis der Radweg schlechter abschneidet, darf man sich über verzerrte Ergebnisse nicht wundern und kommt bei kritischer Betrachtung der Studienlage zu folgendem:
Fazit
Rechnet man alle verzerrenden Einflüsse wie städtebauliche Merkmale, Standardkonformität, Kreuzungsdesign, Radwegebeschaffenheit, demografische Merkmale und vor allem die stark unterschiedlichen Kfz-Verkehrsbelastungen aus den Vergleichen heraus, ergibt sich hinsichtlich der für die Bewertung der Gefährlichkeit von Radwegen allzu oft ausschlaggebenden Unfalldichte ein vollkommen anderes Bild als wir derzeit von Radwegen haben.
Radwege sind sicherer als ihr Ruf! UND sie sind bei direktem Vergleich Radspuren in vielen Belangen überlegen. Das beweisen die Best Practices und die daraus resultierenden, weit höheren Nutzungszahlen aus den Niederlanden und Dänemark – speziell Kopenhagen, aber mittlerweile auch viele kleinere Studien aus den USA und Kanada.*
Radspuren auf der anderen Seite sind die minimalinvasivste Form der Reintegration des Massenverkehrsmittels Fahrrad in den städtischen Verkehrsraum. Die Kommunen nehmen daher die Zahlen der BASt sehr gerne als Aufforderung zur Anlage von Radfahrstreifen wahr, auch weil der Widerstand der Autolobbies sich in den meisten Fällen stärker in Grenzen hält, da der Verlust an Fläche für den ruhenden und fließenden Verkehr meist deutlich geringer ist als bei standardkonformer Anlage von Radwegen.
Aus Radfahrersicht ist das aber ein zweifelhafter Fortschritt, der vor allem aus Trauma der Radwegebenutzungspflicht und der damit einhergehenden Verbannung in den ungeliebten Seitenraum – vulgo Hochbord – ableitet. Diese Diaspora hat viele Vorbehalte gegen Radwege erzeugt und nährt auch noch nach bald einhundert Jahren in Deutschland bei Vielen den innigen Wunsch endlich wieder auf die Straße zurückkehren zu dürfen – auch wenn sich seither viel getan hat und der Straßenverkehr von damals mit dem heutigen schwerlastreichen Innenstadtverkehren nicht mehr viel gemein hat.
Will man aber mehr Menschen für das Rad begeistern, kommt man um bauliche Separation nicht herum. Subjektive Sicherheit ist keine Modeerscheinung sondern der passende Schlüssel zu mehr Radverkehr und damit zu mehr Verkehrsfluss in den mobilitätshungrigen Städten des 21. Jahrhunderts. Aber auch – en passant – zu mehr Inklusion von mobilitätsbeschränkten Verkehrsteilnehmern!
—
Matthias Hueber ist der Gründer des solidarischen Nachbarschaftsnetzwerkes alleNachbarn.de. Er beschäftigt sich mit Stadtentwicklung und deren Auswirkungen auf Kommunikation und Mobilität. Das (E-)Fahrrad und andere (nichtverbrennungsmotorisierte) Kleinstfahrzeuge werden seiner Meinung nach das Auto in den Großstädten in wenigen Jahrzehnten ablösen. Auf dem VCD-Blog „Mobilität 2050“ schreibt er darüber und über gesellschaftspolitische Themen der Verkehrswende.
—
*
– Lessons from the Green Lanes: Evaluating Protected Bike Lanes in the U.S., Chris Monsere et. al., Portland State University, Juni 2014
– INJURY RISK & ROUTE INFRASTRUCTURE, Kay Teschke, University of British Columbia, 2012
– Risk of injury for bicycling on cycle tracks versus in the street, Anne C Lusk, Harvard University, 2014


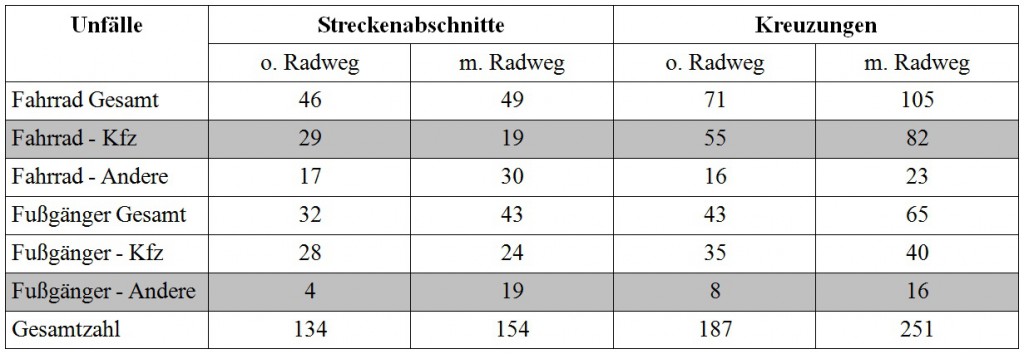
128 Antworten auf „[Gastbeitrag] Dichtung und Wahrheit – Warum Radwege in vergleichenden Studien meist schlecht abschneiden“
Ich finde das Fazit etwas überzogen. Radwege sind unsicherer in Deutschland, das ist Fakt. Sie wären es nicht, wenn die ganzen rausgerechneten Faktoren nicht gegeben wären. Sie sind aber vorhanden und werden es wahrscheinlich auch noch lange.
Eine Zeile. Das ist Fakt. Wow. Ich liebe das ja immer, wenn Menschen mit solcher Kompetenz etwas begruenden. Sie sind schnell fertig, und das fehlende Verständnis zur eigentlichen Diskussion ist selbstverständlich keine mentale Mangelerscheinung, sondern ganz klar Überlegenheit, das ist Fakt.
Wer nicht weiß, was statistische Auswahleffekte, Bias, usw. sind, sollte sich möglicherweise mal ernsthaft zurücknehmen und vor dem nächsten Beitrag etwas Bildung holen gehen.
In Kurz: Die genannten Faktoren sind häufig schwer eindeutig zu identifizieren, quantifizieren und damit zu korrigieren. Damit gelten die ermittelten Größen, aber auch nur noch eingeschränkt. Wenn ich zum Beispiel für eine Studie über den Stand der Statistikkenntnisse in der Bevölkerung nur Gesprächsbeiträge im Internet hernehme, dann ist es völlig klar, dass ich damit meine Stichprobe übermäßig auf Leute mit zu viel Mitteilungsbedürfnis, und höchstwahrscheinlich auf Leute mit bestenfalls ungesundem Viertelwissen einschränke.
Soll heißen, wenn Du brauchbare und halbwegs allgemein auswertbare Daten willst, musst Du die dort besorgen, wo sie verfügbar sind. Das ist derzeit zum Beispiel in den Niederlanden der Fall, wenn man Daten über Auswirkungen großflächig vorhandener Radwege such.
Das Vergleichen von Risiken auf Radwegen mit dem auf der Straße ist eben nicht sinnvoll, weil die Situationen aus denen die Daten kommen nur selten vergleichbar sind.
Die Intention des Beitrags ist es ja gerade die Koordinaten für eine möglichst objektive Bewertung und Anordnung der Radwegeinfrastruktur zurechtzurücken. Wenn man weiterhin schlecht ausgeführte aber per Se sichere Infrastruktur mit standardkonformer (in vielen Fällen vor allem über 20000 Kfz/Tag) unsicherer Radinfra vergleicht, wird man zwangsläufig immer zum falschen Ergebnis kommen, dass Radfahrstreifen und Schutzstreifen sicherer sind.
Klar, wenn man die eine Führungsform schon als sicher definiert vor der Untersuchung, muss das auch rauskommen … oder was soll mir die Aussage, Radwege seien per se sicher, wenn sie denn dann irgendwann einmal so gebaut werden würden, wie sie gebaut werden sollten …
Nein Norbert, hier geht es bestimm nicht darum eine Führungsform gegenüber der anderen zu bevorzugen. Es soll ZUKÜNFTIG lediglich mit vernünftigen Maßstäben gemessen werden, welche Führungsform an welcher Stelle die geeignetste ist. Schutz- oder Radstreifen haben ihre Schutztauglichkeit in vielen urbanen Beriechen längst unter Beweis gestellt, aber sie sind als Patentrezept der Radverkehrsförderung leider denkbar ungeeignet. Das beweisen die vergleichsweise geringen Nutzungszahlen in deutschen Städten.
Gegenfrage: Wem nutzt Radförderung wenn sie nicht vollständig und nachhaltig umgesetzt wird? Die Radstreifenexzesse der Neunziger Jahre sind offensichtlich nicht die richtige Antwort auf die Herausforderungen einer mobilitätshungrigen Urbanität.
Radwege sind besser als Ihr Ruf, das ist die zentrale Aussage, wenn man sie denn endlich mal so anlegt, dass Sie ihre optimale Schutzwirkung voll entfalten können..
Selbst in Kopenhagen hat eine Untersuchung festgestellt, das dort Radfahrer auf Radwegen gefährlicher leben, wie bei Benutzung der Fahrbahn.
Und benutzungspflichtige Hochbordradwege und Radstreifen auf Fahrbahniveau haben laut Regelwerken auch den gleichen Platzbedarf. Nur die nicht benutzungspflichtigen „Schutzstreifen“ bilden da die negative Ausnahme.
Und es ist auch nirgends nachgewiesen das Radwegbau eine Steigerung des Radverkehrsanteils bewirkt. Dieses Beispiel (wiederum aus Kopenhagen:
http://www.rad-spannerei.de/blog/2016/03/17/der-gute-radweg/ )
deutet eher darauf hin, das ein dichtes Radwegenetz vor allem dazu dient, trotz hohem Radverkehrsanteil, Autofahrern freie Fahrt zu sichern.
Super ein Einzelfallbeispiel, wahrscheinlich eine Altlast zu einem „günstigen“ Augenblick (sehr viel Radverkehr, wenig KFZ-Verkehr) dokumentiert. Applaus.
Es ist übrigens in der verkehrswissenschaftlichen Literatur nach meinem Eindruck inzwischen Konsens und auch recht gut belegt, dass Radinfrastruktur mit einer Steigerung des Radverkehrsanteils einhergeht. Der Zusammenhang vorhandener Radinfrastruktur und Risikoverringerrung übrigens auch.
Die BaSt-Studien werden übrigens von einem Ingenieurbüro in Braunschweig im Auftrag erledigt und genügten meiner Ansicht nach nicht immer wissenschaftlichen Standards. Aber das sollte man vielleicht auch nicht überbewerten.
Nein.
Soweit ich mich recht erinnere war der Zusammenhang der Erstveröffentlichung des Videos ein gänzlich anderer: es sollte belegt werden, wie stark die separierten Radwege eine Steigerung des Radverkehrs initiieren. Dass die verkehrliche Qualität dabei auf der Strecke geblieben ist und die erhöhten Reisezeiten zu schlechten Erreichbarkeitsradien führen, wurde – bezeichnenderweise – gar nicht in Erwägung gezogen, bzw. war ausserhalb des ’separierte Radwege sind suuuuper‘ Dogmas.
Aber Kopenhagen ist zugute zu halten, dass erkannt wurde, dass es keinen (einfachen) Zusammenhang zwischen Radverkehrssteigerung und MIV-Rückgang gibt.
MIV Rückgang hat zwingend Repressionen gegenüber dem MIV zur Voraussetzung. Parken (!) und Reisezeit. Die Alternativen des Umweltverbundes gleichzeitig auszubauen kann da sinnvoll sein.
Wer allerdings zugunsten eines einseitig geförderten Radverkehr-Kurzstrecken-Separations-Verkehrs den Fussverkehr und ÖPNV vernachlässigt (oft in den ‚Fahrradhauptstädten‘ zu beobachten), perpetuiert lediglich die Notwendigkeit des Autoverkehrs auf allen Strecken, die die Kurz- und Ultrakurzstrecken übersteigen.
Münster mit seinen hohen Autoverkehrszuwächsen ist da ein gutes Beispiel.
> auf Radwegen gefährlicher leben, wie bei Benutzung der Fahrbahn
Genau das ist der Trick: Obwohl es um Unfälle geht, kommt das Wörtchen „Fahrbahn“ nicht einmal vor. Es handelt sich damit um Schönfärberei.
Unfälle durch rücksichtslos überholende KFZ, wegen denen doch der ganze Radwegefirlefanz eigentlich gemacht wird, sind aber auch im Mischverkehr die absolut exotische Ausnahme. Sie sind weder so häufig noch so schwer, dass sie das milliardenteure Aussortieren der Radfahrer aus dem Strom der übrigen Fahrzeuge rechtfertigen würden. So gerät die ganze Separiererei im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zum Selbstzweck.
Zum Beispiel führt das mehr oder weniger extreme Nahüberholen auf manchen Straßen dazu, dass Menschen, die nicht so sicher sind, oder schlicht gerade keinen Bock auf Stress haben dort gar nicht erst fahren. Natürlich gibt es so weniger Unfälle, als wenn alle Radfahrer dort fahren (müssten).
Fahrräder und KFZ sind schon recht unterschiedliche Fahrzeuggattungen. Hand hoch, wer als Fußgänger gern auf seine „Separiererei zum Selbstzweck“ verzichtet und sich lieber eine Fläche mit Radfahrern, KFZ oder am liebsten mit beiden teilen möchte!
Ich kenne keinen real existierenden Radweg, auf dem man stressfrei fahren kann. Wer die unzähligen Konflikte an Grundstückszufahrten, an Kreuzungen, mit zu Fuß-gehenden Senioren, Kindern oder Autoinsassen, deren Hunden, Straßenmobiliar, Brötchenholern oder Lieferverkehr so erfolgreich ausblendet, dass er dies alles für „stressfrei“ hält, wird sich auch von ein paar Überholern nicht wirklich schrecken lassen.
Fußgänger und Fahrzeuge sind schon schon recht unterschiedliche Verkehrsteilnehmergattungen. Hand hoch, wer als Fußgänger scharf auf „Separiererei zum Selbstzweck“ ist und sich lieber eine Fläche mit Radfahrern teilen möchte!
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über gute Radwege einem Verbrechen gleichkommt
Weil es die Duldung so vieler Kilometer vorhandenen Bockmists einschließt?
Es ist schwierig. Einerseits kann ich Dir zustimmen: Seitdem ich die tatsächlichen Radfahrregeln kenne, fahre ich öfter auf der Fahrbahn als zuvor. Das war in der Tat zuerst stressig, war aber lediglich ein Umgewöhnungseffekt: An Nervereien an Einmündungen mit KFZ und überall sonst mit Fußgängern war ich ja schon gewöhnt, daran noch nicht. Nun bin ich es und finde das Fahrbahnfahren nicht mehr stressig.
Aber: Würde ich einem achtjährigen Kind sagen, dass er das tun solle (da ja erlaubt)? Nein.
„Aber: Würde ich einem achtjährigen Kind sagen, dass er das tun solle (da ja erlaubt)? Nein.“
Würdest du einem achtjährigen Kind den Toten Winkel und die vielen anderen neuralgischen Punkte erklären wollen?
Würdest du (oder jeder andere Mitverkehrsteilnehmer) Kinder gefährden, die du sehen kannst?
@Grossmutter: Leider weiß ich gerade nicht, wieso ich nicht auf Deinen Kommentar vom 23.03.2016 antworten kann. Stattdessen muss ich jetzt hier antworten.
Es ist ungleich viel einfacher, Kindern zu erklären, dass sie überall, wo KFZ kreuzen können (Einfahrten, Einmündungen), erst links und rechts gucken sollen, als:
* Schulterblick
* Linksabbiegen in zwei Phasen
* Spurwechsel im Strom von KFZ
* 1m Abstand nach rechts zu parkenden KFZ halten
Insbesondere das letzte ist toll. Was glaubst Du, was passiert, wenn ein Kind in der Mitte der Spur (best practice) vor einem LKW fährt und angehupt wird. Denkst Du, das wäre eine schöne Situation? Übrigens nicht nur für Kinder. Im Prinzip gilt das für viele Menschen. Die haben keinen Lust auf Kampf auf der Straße. Selbst wenn sie wüssten, dass es auf schlechten Radwegen weitaus risikoreicher zu fahren ist, werden die meisten das in Kauf nehmen.
Der Autor zieht sich aus den Untersuchungen die Teile, die ihm gefallen, andere Fallen unter den Tisch. Mal am Beispiel der Studie „Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern“ betrachtet: Sie hätte weder Radwege noch Radfahrstreifen als eindeutig sicherer ermittelt. Jedoch sei bei beiden entscheidend, dass sie nach den aktuellen Regelwerken angelegt werden. Soweit richtig. Nun hat aber die Studie von Anfang an die Knotenpunkte außen vor gelassen, von denen man weiß, dass sie im Zuge von Radwegen besonders gefährlich sind. Hätte man also Radwegabschnitte inklusive Knoten mit Radfahrstreifenabschnitten inklusive Knoten verglichen (was eine normale Radfahrt von A nach B realistischer wiedergegeben hätte), wäre die Untersuchung eindeutig zu Gunsten der Radfahrstreifen ausgefallen.
Dann tut der Autor so, als seien in Deutschland seit 1997 massenhaft tollste Radfahrstreifen mit Regel- oder Luxusbreiten angelegt worden. Da habe ich aber andere Daten …
Der Autor kommt selbst auf den Gedanken, dass Radwege oft unzureichen breit sind, offenbar nicht vernünftig instand gehalten werden … Er zieht daraus den Schluss, man müsse sie breiter bauen und besser instand halten. Das ist offenbar nach dem Motto: „Hat zwar noch nie funktioniert, wird aber sicher besser, wenn wir mehr davon machen“. Nein, wenn etwas nicht funktioniert – aus welchen Gründen auch immer -, dann muss man es anders machen. Nämlich so, dass die erkannten Probleme nicht erneut eingebaut werden.
Ja, wir wollen sicheren Radverkehr. Der Radfahrstreifen löst nicht jedes Problem, der Radweg aber schon gar nicht.
Hätten die nur gewusst, dass sie nur Dich fragen müssen um ein Ergebnis zu bekommen. Knotenpunkte waren offensichtlich nicht in der Fragestellung. Deshalb wird vereinfacht und eben nicht die Gesamtsituation betrachtet. Wobei letzteres praktisch auch nicht wirklich zu erfassen ist, weil es zuviele unkontrollierbare äußere Einflüsse gibt.
In dem Teil von Deutschland von 1997, den ich kenne, gab es wesentlich weniger auch nur entfernt zumutbare Radinfrastruktur. Und wenn ich heute so rumkomme fällt mir durchaus auch häufig mal was neu gebautes auf, dass es 1997 mit Sicherheit so nicht gegeben hätte. Das hängt aber sicher stark an der Region. Luxusbreite Radwege kommen nicht so häufig vor. Aber mal ehrlich, für Leute die aus Prinzip dagegen sind, ist doch die Breite auch unerheblich, oder?
Im Übrigen, auf die eine oder andere Form der Separation läuft es hinaus: Separation der Verkehrsarten, oder Separation der (auch potentiellen) Radfahrer, weil ein Teil auf der Strecke bleibt, sich eben nicht in den Kraftverkehr mischen mag oder kann.
Mich wundern die abweisenden Reaktionen hier.
Als Holländer habe ich eine ganz pragmatische Sichtweise auf die Radinfrastruktur: In Holland funktioniert sie hervorragend und stellt für mich deswegen ein „best practice“ dar. Dafür brauche ICH keine Zahlen.
Die separate Radinfrastruktur in den Niederlanden hat nichts zu tun mit „dem Autoverkehr nachgeben“. Im Gegenteil: Die Radwege brauchen Platz, der dem Kfz-Verkehr abgezogen wird. Die Ampelkreuzungen kennen ausnahmslos eigene Ampeln und Grünphasen für den Radverkehr. Die Kreisverkehre mit umlaufenden Radweg sind so gestaltet, dass der Kfz-Verkehr sowohl beim Rein- als auch beim Rausfahren dem Radverkehr Vorfahrt gewähren muss.
All diese Maßnahmen machen das Radfahren in NL sicherer und angenehmer. Es gibt deshalb auch keine Diskussion über Radwegebenutzungspflicht. Die Frage stellt sich einfach nicht.
Weitere Vorteile von separaten Radwegen: Kein Warten hinter stinkenden Autoschlangen vor Ampeln, weil man ungestört vorbei fahren kann; Flüssiges Rechtsabbiegen an Kreuzungen, ohne vor unsinnige Auto-Ampeln warten zu müssen; klare Führung des Radverkehrs zum Linksabbiegen, oftmals mit eigens dafür optimierte Ampelschaltungen.
Durch die separate Infrastruktur trauen sich Bevölkerungsgruppen aufs Rad, die das bei uns nicht tun. In Deutschland sieht man kaum Kinder, Jugendliche und Ältere in den Städten Rad fahren. In Holland ganz normal. In Deutschland sind hauptsächlich die männlichen „Furchtlosen“ (10% der Bevölkerung) im Stadtgetümmel auf dem Rad unterwegs. Damit schafft man aber keine Mobilitätswende. Dafür ist eine breite Masse erfoderlich. Die Masse erzeugt automatisch mehr Sicherheit (safety by numbers). Und ja, das kostet eine Stange Geld und viel politische Überzeugungsarbeit.
Natürlich darf jeder der Meinung sein, dass wir keine separate Radwege in Deutschland brauchen, aber aus meiner Sicht ist das die einzige Alternative zu den halbherzigen Lösungen, die wir aktuell überall vorfinden und die nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Radverkehrsanteils führen.
Danke für diesen Beitrag. Wer einmal die Infrastruktur in Holland gesehen und genutzt hat fragt sich, was diese ganze Diskussion soll. Wenn man wirklich mehr Radverkehr möchte und das mehr Menschen, gerade Frauen, Kinder und Älter, Radfahren, sollte man die Diskussion einstellen und endlich daran arbeiten, die sehr guten Lösungen aus Holland in Deutschland umzusetzen. Ich selber gehöre zu den 10% Furchtlosen aber ich würde auch gern mit Freunden, meiner Tochter oder meiner Frau entspannt neben einander fahren, so wie ich es in Holland erlebt habe und nicht ständig den Kampf mit verrücken Autofahrern führen zu müssen.
Dass pro Weg das Risiko für einen tödlichen Unfall in NL höher ist als in D, und dass auch in den Niederlanden der Autoverkehr beständig ansteigt ist aber m.E. durchaus erwähnenswert.
„Mich wundern die abweisenden Reaktionen hier.
Als Holländer habe ich eine ganz pragmatische Sichtweise auf die Radinfrastruktur: In Holland funktioniert sie hervorragend und stellt für mich deswegen ein „best practice“ dar. Dafür brauche ICH keine Zahlen.“
Du hast gut reden. Als Holländer musst du auch keine Autos verkaufen. ;-)
ist zwar schon länger her,aber darauf trotzdem ne Antwort:
(Zitat)“Die Ampelkreuzungen kennen ausnahmslos eigene Ampeln und Grünphasen für den Radverkehr.“
Bei uns gibts auch eigene Ampeln für Fahrräder, nur haben die oft gleiche Grünphasen mit Fahrbahn und/oder Fußgängern. Dummerweise ist nun noch eine Richtlinie in Kraft getreten, die „alte“ separate Fahrradampeln mit rot/grün-Signalisierung verbietet und fordert, dass neue Ampeln (Rot-Gelb-Grün) vor dem Überweg installiert werden. Auch diese neuen Ampeln kommen in Sachen separate Grünphase oder Sicherheitsgewinn nicht immer den Anforderungen nach.
Da diese neuen Ampeln teilweise an alte Radwege gebaut wurden, wurden teilweise auf so schon schmalen Wegen nochmal Spuren gemalt, die die Mindestbreite der Radwege unterschreiten und zum eigentlich unzulässigen Rechtsüberholen zwingen.
An einigen Kreuzungen ist es so, dass die neue Querspur der Radfahrer von links direkt entlang der Haltelinie der anderen Radfahrer geführt wird, damit sind gegenseitige Behinderungen vorprogrammiert.
(Zitat)“Die Kreisverkehre mit umlaufenden Radweg sind so gestaltet, dass der Kfz-Verkehr sowohl beim Rein- als auch beim Rausfahren dem Radverkehr Vorfahrt gewähren muss.“
An Kreiseln und Kreuzungen/Einmündungen mit begleitenden Radwegen bekommen Radfahrer hier trotz Fahrtverlauf auf der Vorfahrtstraße ein kleines Zeichen 205 vor die Nase gesetzt, dass hier dem Kraftverkehr auf der Fahrbahn Vorrang zu gewähren ist. Verwirrend ist das dann insbesondere dann, weil ja der Kraftverkehr der untergeordneten Straßen ebenfalls ein Zeichen 205 hat.
Von langen Wartezeiten an so genannten Bettelampeln, Grünphasen mit 3 Sekunden Grünlicht und Ampeln hinter Mittelinseln von mehrspurigen Straßen, die eher grün und rot werden als die vorderen Ampeln in der Mittelinsel rede ich besser nicht ausführlich. Man braucht hier jedenfalls gute Nerven um nicht auszurasten, wenn man nach 10 Metern wieder vor einer roten Ampel steht.
Wow! Gerade ein paar Tage wieder zu Hause, und schon wird der Blog weitergeführt. Daumen hoch!
Ein paar Anmerkungen zum Artikel möchte ich beisteuern:
in den Niederlanden ist also das Sicherheitslevel wegen der guten benutzungspflichtigen Radwege viel höher. Und gerade auch die Schwächeren werden mit der ‚Geschützten Infrastruktur‘ ‚geschützt‘.
Wenn ich aber mal nachschaue, dann finde ich für 2014 in den NL 184 getötete RadfahrerInnen mit einem sehr hohen Anteil von besonders gut ‚geschützten‘ Senioren.
Bezogen auf die Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten Wege (also den unterschiedlichen Wege-modal-split eingerechnet) ist das ein höheres Risiko als in Deutschland! Hmmm.
Sehr seltsam.
Das müsste doch dann eigentlich ganz anders aussehen: in den NL ist doch alles so sicher mit den separierten Wegen und dem zusätzlich viel besseren Kreuzungsdesign? Zusätzlich ’safety by numbers‘. Warum ist dann pro mit dem Rad gefahrenem Weg ein höheres Todesrisiko gegeben???
Bezogen auf die KM-Leistung (Tote je gefahrenem KM) sieht es in NL besser aus als in D, was allerdings m.E. (subjektiver Eindruck) darauf zurückgeht, dass gerade an hochfrequentierten Strecken, auf denen viele KM zurückgelegte werden (Radschnellwege, etc.) planfrei konstruiert wird oder zumindest die Anzahl der Kreuzungen/Einmündungen/Knotenpunkte gering gehalten wird. Kreuzungsfreier Längsverkehr auf 4-Meter-Radwegen mit Top Oberfläche (ohne Fussgänger) ist in der Tat sehr sicher (kostet aber auch im Mittel ca. 1,2-1,5 Mio. EUR pro Kilometer).
Das Ganze scheint mir ein sehr wacklig konstruiertes Kartenhaus zu sein.
Hauptsache noch mehr Radwege, und Hauptsache freie Fahrt für Autos auf der von Radfahrern gesäuberten Fahrbahn.
Denn das kommt ja dann in aller Regel als nächstes: ‚die Aufhebung der Benutzungpflicht verhindert, dass bessere Radwege nach Niederländischem Vorbild gebaut werden‘ oder so, , etc, etc, etc.
Unterstellung?
Typischerweise lehnt der Gastautor an anderer Stelle das Konzept der dualen Infrastruktur rundheraus ab und will tatsächlich wieder die allgemeine Benutzungspflicht einführen mit der Folge, dass an allen Auto-relevanten Strecken die Kapazität des MIV maximal ausgeschöpft wird:
„Die freie Wahl der Wege für Radfahrer führt zu massiver Unsicherheit bei den Radfahrern selber, bei Fußgängern und vor allem bei Autofahrern.“
http://www.zukunft-mobilitaet.net/79077/verkehrssicherheit/radverkehrsfoerderung-bedeutung-von-radwegen-und-radfahrstreifen-subjektives-sicherheitsgefuehl-verkehrssicherheit/
Auch in diesem Artikel wieder:
„Will man aber mehr Menschen für das Rad begeistern, kommt man um bauliche Separation nicht herum. Subjektive Sicherheit ist keine Modeerscheinung sondern der passende Schlüssel zu mehr Radverkehr und damit zu mehr Verkehrsfluss in den mobilitätshungrigen Städten des 21. Jahrhunderts. “
Darum gehts also? noch mehr Verkehrsfluss?
Nein Danke!
Dann lieber ganz altmodisch ‚autofeindlich‘, was ja scheinbar wieder ‚out‘ ist: mehr Mobilität mit weniger Verkehr, mit mehr Raumwderstand für den MIV, etc. ‚Push and Pull‘ incl. starker Repressionen gegen den MIV werden gebraucht, statt noch „mehr Verkehrsfluss“.
Aber stattdessen zurück in die 80er: überall miese benutzungspflichtige Wegelchen (oder nach neuem Duktus: überall Versuchen von gaaaanz tollen niederländischen Edel-Radwegen zu trotzdem gaaaanz günstigen Erstellungkosten), und de facto noch ein paar Jahrzehnte obendrauf, in denen den Radfahrenden mal wieder der „Bessere“ Radweg versprochen wird. Jetzt aber ganz bestimmt, und ganz sicher für die Senioren, etc, etc., während der Autoverkehr auf der schönen Fahrbahn nebenan unverdrossen anwächst, wie er das in den Niederlanden übrigens ebenfalls – allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz – tut.
Das ist ziemlich genau das, was auch bei AGFS als „Nahmobilität 2.0“ verbraten wird: Radfahren ist dann was für die Kurzstrecke als alternativer Fuss-Ersatzverkehr, der innerhalb des Umweltverbundes in Konkurrenz zu Fuss und ÖPNV tritt, während für alle Entfernungen oberhalb des zusammengeschrumpften Rad-Radius von 1-4 KM das „ernsthafte“ Verkehrsmittel Auto weiter benutzt und vorgehalten werden muss.
Gleichberechtigung der Verkehrsmittel ist da sogar als Ziel genannt.
Die meisten ‚Fahrradstädte‘ mit benutzungspflichtigen separierten Radwegen haben gleichzeitig viel Autoverkehr und oft eine hohe Verkehrsleistung des MIV, wenn die Auswärtigen-Verkehre mit eingerechnet werden. Die Radfahrer machen da tatsächlich Platz für mehr Autos, weswegen zu den (wenigen) Verkehrsunfalltoten die bereits hohe Zahl der Abgastoten noch weiter nach oben getrieben wird. Wen trifft es? Die eigentlich schützenswerten Alten, Kranken und Schwachen.
Na toll.
Fahrradhautpstadt-Münster ist ein gutes Beispiel für radkial ansteigende Autoverkehre bei 100% benutzungpflichtiger separierter Radinfrastruktur.
Traurig, dass sowas auch vom VCD kommt. Da scheint wohl auch de facto trotz zig-tausender Abgastoten und steigener Meeresspiegel immer mehr das AUTO als „gleichberechtigtes“ Verkehrsmittel promotet zu werden?
Ich habe nichts gegen gute Radwege, und obschon ich oft auf der Fahrbahn fahre, zähle ich mich nicht zum neuen „Feindbild NR.1“ dem berüchtigten Lager der dogmatischen „VC“, welche es angeblich geben soll, und welche angeblich unsere Kinder auf die 8-spurige Hauptverkehrsstrasse in der Rush-hour hetzen wollen, alle Radwege sofort abreissen wollen, etc.,
aber ich habe langsam genug von PR-Kampagnen, die den Radverkehr mit immer mehr Fahrbahnverboten eindampfen wollen und für alle Strecken oberhalb von „Nahverkehr 2.0-Entfernung“ Autovorhaltung und Autonutzung de facto noch stärker etablieren wollen. Denn genau das kommt dabei letztlich heraus, weil der noch stärker verlangsamte Radverkehr auf Strecken oberhalb der „Nahmobilität“ aus den Reisezeitbudgets fällt. Wer viel Glück hat erwischt dann noch eine Strecke, auf der zur gewünschten Hin-/ Rückzeit der ÖPNV zur Verfügung steht, was aber immer seltener der Fall ist.
Also doch wieder zurück ins Auto?
Das Rad nur für Tourismus, Sport und die städtischen Kurzstrecken, um den Stau zu vermindern und für die längeren Autostrecken genug freie Fahrbahn-Kapazitäten vorzuhalten und sich über „mehr Verkehrsfluss“ freuen?
Mir ist kaum ein Land bekannt, in dem es sich so gut und zügig Autofahren lässt wie in den NL. Kein Wunder, dass der Autoverkehr dort immer mehr ansteigt. Wo es doch mal zum Stau kommt sorgen separierte Radschnellwege dann wieder für guten ‚Verkehrsfluss‘.
Die werden dort gebaut, wo Autostau ist, nicht dort, wo am ehesten der Autoverkehr zurückzudrängen wäre.
Wieso soll eine Verkehrspolitik, die nachweislich zu einer Steigerung des MIV führt ein leuchtendes Vorbild für uns sein?
Warum nicht Wien? Oslo? Selbst London (nicht gerade eine Fahrrad-Vorzeigestadt) konnte mit City-Maut den MIV in kurzer Zeit um 30% reduzieren.
Wenn der Autoverkehr auf Planeten- und Menschenverträgliche 5%-10% von heute geschrumpft ist, dann braucht es diese ganze Radwege ohnehin nicht mehr, sondern es gibt wieder eine friedliche Koexistenz innerhalb des Umweltverbundes (Knoflacher und Co.). Wien ist da auf einem weit besseren Weg als Amsterdam, und berücksichtigt auch die Belange Älterer besser, da dort im Ggs. zu Amsterdam ein entspannter Fussverkehr mit gutem ÖPNV erhalten/wiederhergestellt wurde. Die Autonutzung geht dort in den nächsten Jahren realistisch auf ca. 20% (Einwohner-Wege-ModalSpit) zurück. Davon kann das Radwege-Benutzungspflicht-Amsterdam nur träumen, auch wenn die NL-Agenturen gern 22% modal-split-Autoverkehr für Amsterdam publizieren (da wird dann erst im Kleingedruckten klar, dass ‚kreativ‘ der Fussverkehr rausgenommen wurde und nur der ‚Fahrverkehr‘ zugrunde gelegt ist. Ein Schelm, wer böses dabei denkt …). Ja, Wien benutzt dazu auch Radwege. Warum nicht, wenn es im Gesamtsystem hilft den Autoverkehr zu beschneiden.
Zu BAST 184: wer darüber schreibt sollte schon erwähnen, dass bei den dortigen Zahlen die größeren Knotenpunkte bei der Betrachtung der Radwege ausgeklammert worden sind (!), wobei das zugegebenermassen dort sehr schlecht ersichtlich ist.
Wer zu ‚best-practice‘ Kopenhagen schreibt sollte m.E. erwähnen, dass die Radwege dort zu einem recht langsamen Radverkehr geführt haben. Der geplante Mittelstreckenverkehr mit seinen separierten Radwegen läuft soviel ich hörte schlecht an (habe leider keine Zahlen).
Immerhin scheint das Problem erkannt worden zu sein, und es wurde beschlossen eine immerin 1%-ige Beschleunigung des verlangsamten Radverkehrs pro Jahr zu erreichen.
Für eine Verkehrswende sind viele Veränderungen notwendig. Eine dumme dogmatische Wiedereinführung des Fahrbahnverbots für Radfahrende – wie hier nahegelegt – gehört m.E. nicht dazu, ebensowenig, wie eine ausschliessliche Fahrbahnführung ohne alternative Führung (Erlebnisse des Blogbetreibers in Australien). Radfahrende sind halt keine homogene Gruppe! Für die Einen sind Radwege ein Grund wieder das Auto zu nehmen, für die Anderen ist es die Abwesenheit von Radwegen. Die in Artikel aufgeworfene Frage nach dem Nutzen von Fahrbahnmalereien (Schutz-Rad-Streifen) gilt es im Blick zu behalten. Da sind die Pilot-Untersuchungsstrecken der BAST m.E. tatsächlich unzureichend gewählt.
Der hier vorgeschlagene Roll-back in die 80er allerdings nutzt nur dem Autoverkehr.
@ Hannes
eine ernstgemeinte Frage: bist Du ein weiterer Nickname von Günther/Strizzi/Kleinelch? Dein aggressiver und abwertender Grundton gegenüber Mit-Kommentatoren lässt mich dies vermuten.
Warum nicht etwas freundlicher und entspannter?
„@ Hannes
eine ernstgemeinte Frage: bist Du ein weiterer Nickname von Günther/Strizzi/Kleinelch? Dein aggressiver und abwertender Grundton gegenüber Mit-Kommentatoren lässt mich dies vermuten.
Warum nicht etwas freundlicher und entspannter?“
@Alfons Krückmann
eine ernstgemeinte Frage: Bist du ein weiterer aka bzw Ghostwriter von Siegfried Brockmann, UDV?
Du bist ähnlich rührig und militant gegen die Herausforderung der Kfz-Lobby durch das holländische Beispiel incl der geschützten Radinfra unterwegs.
Du argumentierst ähnlich aggressiv und gleichzeitg die Argumente bis zur Komik verdrehend wie der Schreiber von Brockmanns Blog z.B. in seiner Suada gegen Tempo 30:
„Die Radfahrer, deren Lobby das gerade am stärksten fordert, würden übrigens vergleichsweise am Wenigsten profitieren….
Ich erwarte daher, dass die Missachtung, die schon heute in 30-Bereichen verbreitet ist, nicht nur der Menge nach, sondern auch der Höhe nach dann eher zunimmt.
Erreicht hätten wir also nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit….“
http://verkehrssicherheit.org/de/blog/tempo-30-staedte
(Der Kfz-Versicherungsverkäufer Brocki, sein Herz schlägt für den Radverkehr, warnt die Radfahrer mal nicht vor den bösen Niederländern, sondern vor den fiesen Tücken eines flächendeckenden Tempo 30.)
@Vorstadt-Strizzi
Was willst du mitteilen?
Hier mal ein paar Fakten zu den vielen Unfalltoten Radfahrern in den Niederlanden, die sie sicherlich auch kennen, aber geflissentlich verschweigen:
– Nur 10% der Fahrrad-Unfälle in NL sind mit PKW-Beteiligung (In Berlin sind es – trotz der vielen Radspuren ? – aber um die 80%)
– Der Fahrradfahrer-Anteil im Schul- und Berufsverkehr ist in NL mehr als viermal so hoch (Im Freizeitverkehr entstehen naturgemäß weniger schwere Unfälle)
– In NL gibt es sehr viele (illegale) Scooter-Fahrer, die zum großen Teil mit bis zu 50km/h auf den Radwegen unterwegs sind (Die Niederländer denken wegen der hohen Unfallzahlen seit längerem über ein Verbot nach)
Natürlich entstehen dort wo mehr mit dem Rad gefahren wird, mehr – leider auch schwere – Unfälle. Die Separation ist aber garantiert nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass man in den Niederlanden mit dem Ausbau physisch getrennter Radwege wegen des unglaublichen Fahrradbooms gar nicht mehr hinterher kommt und zunehmend mehr Fietser, aber auch Bromfiester und Snorfietser um den begrenzten Verkehrsraum konkurrieren. Gerade die vielen Rollerfahrer, die relativ gefahrlos auch auf der Straße fahren könnten, zeigen aber sehr eindrucksvoll, dass die Radwege ein besseres Angebot für Zweiradfahrer darstellen hinsichtlich Sicherheit UND Geschwindigkeit!
Das Dilemma:
Sehr viele gefährliche Situationen entstehen also gerade durch die positiven Nutzungs-Effekte der Separation AUF dem Radweg durch Radfahrer bzw. Alleinunfälle durch die insgesamt höheren Geschwindigkeiten, die durch konsequente Separation möglich sind. Wer sich ein bisschen mit Unfallforschung in diesem Bereich beschäftigt hat, weiß, dass Zusammenstöße zwischen Radfahrenden in vielen Fällen mit schweren und schwersten Verletzungen enden.
FAZIT: Wer mit Fatalities gegen niederländische Radinfra polemisiert und die obigen Fakten verschweigt, kennt entweder die niederländischen Verhältnisse nicht besonders gut oder muss sich ernsthaft fragen lassen, ob ihm an einer objektiven Beurteilung sicherer Radinfra gelegen ist.
Aha,
und wieso genau ist jetzt ein tödlicher Rad-Rad Unfall weniger schlimm als ein tödlicher Rad-Kfz Unfall?
Tot ist Tot!
Oder sollen sich die NL-Toten jetzt ganz fahrradfreundlich freuen, dass sie nicht vom Auto totgefahren wurden, sondern von einem anderen Fahrrad?
Was die Tatsache angeht, dass in NL mehr Wege mit dem Rad gefahren werden als in D: das habe ich oben ja schon rausgerechnet.
„Aha, und wieso genau ist jetzt ein tödlicher Rad-Rad Unfall weniger schlimm als ein tödlicher Rad-Kfz Unfall? Tot ist Tot!“
Oh si tacuisses, philosophus mansisses möchte man dem Herrn Krückmann ja gerne zurufen, aber wahrscheinlich würde er auch das in gewohnter Art und Weise missverstehen.
Mit dieser äußerst befremdlichen Aussage könnte die Automobillobby gut und gerne Werbung machen für Ihr seit zwanzig Jahren höchst erfolgreiches Konzept des Radverkehrsverhinderung durch Mischverkehr und VC, aus der Feder eines angeblichen „Radaktivisten“ wirkt diese Feststellung aber reichlich Pietätreduziert.
Warum? Um genau dieses Problem, dreht sich der obige Beitrag von der ersten bis zur letzten Zeile und die ganz große Mehrzahl der Kommentare darunter:
Nicht die Radwege (Schutz- oder Radstreifen) sind das Problem, sondern „NICHT STANDARDKONFORME RADVERKEHRSANLAGEN“ bzw. solche, die dem Verkehrsgeschehen nicht (mehr) gewachsen sind.
In NL ist Letzteres durch den Boom, den sie ausgelöst haben der Fall, während in Deutschland es veraltete Radwege sind, die zudem miserabel gewartet werden.
Wer „es schafft“ diesen zentralen Unterschied zu übersehen und beides unbeirrt von Fakten gegenüberstellt, wird zurecht in der Debatte um zukunftsfähige urbane Mobilität nicht besonders ernst genommen!
„Was die Tatsache angeht, dass in NL mehr Wege mit dem Rad gefahren werden als in D: das habe ich oben ja schon rausgerechnet.“.
Ich werde mich hüten, eine der wenigen richtigen Annahmen des kommentierten Posts zu kritisieren!
aber nochmal: nicht nur die Anzahl der Wege ist höher, sondern vor allem der verkehrliche Kontext in dem sie stattfinden:
„Der Fahrradfahrer-Anteil im Schul- und Berufsverkehr ist in NL mehr als viermal so hoch (Im Freizeitverkehr entstehen naturgemäß weniger schwere Unfälle)“
In den Niederlanden sprechen also weder die absoluten noch die relativen Unfallzahlen für die Gefährlichkeit von separierten Radwegen oder deren Kreuzungen (wenn man sich die Zahlen genau anschaut)!
Schöner Artikel.
Obwohl die BASt natürlich schon dadurch verbrannt ist, dass sie der Kfz-Lobbyhöhle BMV angehört (das orwellsche I für „Innovation“, das man neuerdings immer mitbeten muss,geschenkt).
Es gibt schwere handwerkliche Fehler in dieser BASt Studie. Auf einige hat der Autor oben zu Recht hingewiesen.
Auffällig ist auch, dass Studien deutscher Provenienz den Zusammenhang zwischen Radverkehrsanteilen und Unfallhäufigkeit meiden wie der Teufel das Weihwasser.
Die UDV hat das einmal versucht, bei Unfällen Abbiegende Kfz vs geradeausfahrende Radfahrer. Man musste dort feststellen, dass in Münster mit seinen vielen Radwegen die Radfahrer mehr als doppelt so sicher vor Abbiegeunfällen sind als in den 3 Vergleichsstädten. Obendrein war in Münster die durchschnittliche Unfallkostenrate am weitaus geringsten.
Für diese hoch signifikanten Ergebnisse musste man allerdings die Studie selbst lesen. In der Präsentation kein Wort davon.
Ich bin mittlerweile zu der Ansicht gelangt, dass der Vergleich von Unfallzahlen nur wenig aussagekräftig ist.
Unfallzahlen sind ein Parameter unter vielen, die Sicherheit beschreiben. Für sich genommen taugen sie zu nichts. Sie gar mit der viel beschworenen „objektiven Sicherheit“ gleichzusetzen, wie es in einigen Radlerkreisen üblich ist, das ist mathematisch-statistisch völlig unhaltbar.
Ein Gedankenexperiment:
Man stelle sich Folgendes vor: Nach den sog. „Sylvesterereignissen“ passiert nichts weiter, als dass Frauen bei den nächsten dieser Großevents zunehmend zu Hause bleiben. Es kommt dadurch zu wenigeren sexuell konnotierten Übergriffen und die Zahl der Anzeigen sinkt. Die an der nun sinkenden Zahl der eingegangenen Anzeigen abgelesene „objektive Sicherheit“ wäre dann gestiegen.
Das wäre natürlich völliger Humbug. Selbst bei gleichbleibender Brutto-Besucherzahl muss man die sich ändernde Zusammensetzung der Grundgesamtheit mit einbeziehen.
Die Unterscheidung zwischen absoluten Zahlen (hier: die Anzahl der eingegangenen Anzeigen)und relativen Zahlen (hier: Anzahl der eingegangenen Anzeigen geteilt durch die Anzahl der Frauen. Und nicht: Anzahl der Anzeigen geteilt durch Anzahl der Besucher) macht Statistik überhaupt erst aus.
Die ganz unterschiedliche Unfalldisposition von Männern und Frauen sowie von den unterschiedlichen Alterskohorten (Unfallschwerpunkte: unter 16J und über 65J) macht einen statistischen Vergleich allein über die Anzahl der Unfälle, Zahl der Toten/Mill km etc unmöglich.
Allenfalls grobe Näherungen sind so möglich.
Ganz erstaunlich ist z.B., dass die Niederlande das für Radler mit Abstand sicherste Land der Welt sind. Um diese Tatsache richtig einzuordnen, muss man in Rechnung stellen, dass die unfallträchtigsten Alterskohorten, nämlich die ganz Jungen sowie die sehr Alten, in keinem anderen Land so stark im Radverkehr vertreten sind und damit auch die Unfallstatistik so stark belasten wie nirgends anders.
Zurück zum Problem der Darstellung und damit der Vergleichbarkeit von Sicherheit im Radverkehr.
Ich schlage ein Verfahren vor, das bereits in der Ökologie mit gutem Erfolg angewandt wird.
Sicherheit, d.h. die Stabilität die Gefährdung von Ökosystemen (Flussläufe, best. Wälder, etc pp) wird anhand des Vorkommens von „Zeigerarten“ überwacht. Diese Zeigerarten werden deshalb auch Indikatoren genannt.
Bei diesen Indikatoren handelt es sich um für das jeweilige System typische, jedoch ökologisch wenig potente Arten. Bei Belastungen werden sie schnell weniger bzw ziehen sich ganz zurück.
Für den Radverkehr typische und gleichzeitig wenig risikotolerante „Indikatoren“ sind Kinder, Senioren und Frauen, etwa in dieser Reihenfolge.
Ich bin der Überzeugung, dass der prozentuale Anteil dieser „Indikatoren“ am jeweils einzuschätzenden oder zu vergleichenden Radverkehr bzw Radverkehrsführungen wesentlich genauere, fundiertere und aussagekräftigere sicherheitsmässige Einschätzungen zulässt als der Vergleich von Unfallzahlen völlig unterschiedlicher Radfahrerkollektive.
Die Überlegungen enthalten eine, neben anderen, besonders gravierende Fehlannahme und zwar wird unterstellt, daß es einen Zusammenhang zwischen der KFZ-Verkehrsstärke zur Radverkehrsunfalldichte gäbe. Für diese Annahme gibt es aber keinen Grund. Das steht sogar in BASt V 184 explizit so drin. „Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“ Ganz im Gegenteil, es finden sich Hinweise darauf, daß Hochbordradwege auch bei einer DTV von 50.000 KFZ keinen Sicherheitsvorteil gegenüber Mischverkehrs bieten und das bereits eine geringe Anzahl Radfahrer auf der Fahrbahn das Unfallrisiko aller Verkehrsteilnehmer senken. Die entsprechende ERA-Grafik ist in Bezug auf die KFZ-Verkehrsbelastung nämlich frei erfunden. Was mir auch noch sehr negativ aufgefallen ist, wäre der Glaube daran, daß man Radwege nur sicher genug gestalten müsse. Mir ist in 40 Jahren in denen ich das Fahrrad als Verkehrsmittel benutze nicht ein einziger Radweg untergekommen, der den einschlägigen Vorschriften oder gar Empfehlungen entsprochen hätte.
Und selbst neu angelegte Radverkehrsanlagen warten mit gravierenden Sicherheitsmängeln auf, sind meist
mindestmaßig und die Oberflächen sind häufig schon im Neuzustand minderwertiger Qualität. Als Radfahrer sollte man das eigentlich wissen. Und von diesen Wegelchen sollen jetzt Radfahrer noch mehr bekommen?
Nein Danke! Die Autofahrer hierzustadt sind schon viel weiter als die Radfahrer, die kommen nämlich mit mir auf der Fahrbahn in der überwältigenden Mehrheit recht gut zurecht.
Hallo Markus Luft,
„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“
Genau diese Formulierung bedeutet eben nicht, dass der Kfz-Verkehr keinen Einfluss hat auf die Unfalldichte AN und AUF Radverkehrsanlagen! Sie sagt viel mehr aus, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt, zwischen der Unfallgefahr der unterschiedlichen Radwegetypen in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke – Das ist ein ganz bedeutender Unterschied, der zu ihrem Missverständnis führt.
Praktisch heißt das, dass man im Grunde genommen jeden Radanlagentyp an jede Straße bauen kann – die Unfallhäufigkeit unterscheidet sich (bei den untersuchten Anlagen) kaum. ABER: Natürlich entstehen trotzdem sehr viel mehr Konflikte an stärker belasteten Strecken – völlig unabhängig vom Radwegetyp.
Die in der Grafik dargestellte Anordnung von Radwegen an stark frequentierten Straßen, führt nun dazu, dass die Unfalldichte-Werte sich stark zuungunsten von Radwegen auswirken.
Entschuldigung, aber das ist doch kompletter Unsinn.
Zitat aus der Studie:
„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs. Auch bei den Straßen mit Schutzstreifen, die insbesondere auch von Lkw oder Bussen mitgenutzt werden können, konnte zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte kein belastbarer Zusammenhang nachgewiesen werden.“
Was daran ist so schwer verständlich?
Später wird es dann noch deutlicher:
„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a)
kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen
weist Verkehrsstärken zwischen 18 und
38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des
am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt
mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des
in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“
und für die, die es immer noch nicht verstehen wollen:
„die fehlenden Zusammenhänge zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte lassen prägende Einflüsse baulich-betrieblicher Einzelmerkmale oder von situativen Fehlverhaltensweisen auf das Unfallgeschehen erwarten.“
Aber ich ahne es schon: ähnlich wie bei Strizzis kreativen Deutungen der UDV-Studie haben die Autoren bestimmt wieder ihre eigene Studie nicht verstanden, oder so ?
Lieber Herr Krückmann,
nein, es ist kein Unsinn, nur weil sie partout nicht zwischen Unfalldichte bezogen auf Radwegetyp und Unfalldichte bezogen auf Kfz-Verkehrsstärke ausreichend differenzieren. Beides sind völlig unterschiedliche paar Stiefel. NOCHMAL:
„Bei KEINEM DER ANLAGETYPEN besteht ein belastbarer Zusammenhang ZWISCHEN DER KFZ-VERKEHRSSTÄRKE UND DER UNFALLDICHTE DES RADVERKEHRS…“
Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke. Das heißt, man kann annehmen, dass nicht mehr oder weniger Unfälle passieren an einer Straße mit einer Verkehrsbelastung x wenn man einen Schutzstreifen oder einen Radweg anlegt (Das heißt aber vor allem AUCH, dass Radwege in ihrer jetzigen Form schon nicht wesentlich unsicherer sind als Schutzstreifen bzw. Radfahrstreifen, trotz veralteter Bauweise und meist unzureichender Pflege!)
Dass nun an einer Straße mit einer höheren Kfz-Verkehrsbelastung y oder z die Anzahl der Konflikte gleichbleibt ist aber logisch nicht aus der oben zitierten Aussage erschließbar. Wie kommen Sie darauf?
Selbstverständlich steigt die Konfliktrate mit der Anzahl der Benutzer, sei es auf oder neben dem Radweg, das werden doch sogar Sie nicht ernsthaft bestreiten wollen. Für die Unfalldichte in Bezug auf die Radverkehrsstärken ist dieser Zusammenhang doch völlig unstrittig und in Bezug auf die problematischen Unfallzahlen der Radwegehauptstadt Münster ein gern genommenes Argument gegen Radwege aus Ihrer Schublade.
„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a) kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen weist Verkehrsstärken zwischen 18 und 38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“
Lesen Sie sich dazu doch bitte einfach noch einmal Punkt 4 durch! Im Beitrag geht es doch genau darum, dass man standardkonforme Äpfel nicht mit Birnen aus städteplanerischer Steinzeit vergleichen soll. Genau diese Aussage impliziert aber eine Vergleichbarkeit, die aufgrund der völlig unterschiedlichen Standards nicht gegeben ist.
„Dass nun an einer Straße mit einer höheren Kfz-Verkehrsbelastung y oder z die Anzahl der Konflikte gleichbleibt ist aber logisch nicht aus der oben zitierten Aussage erschließbar.“
„Safety in Numbers“ funktioniert auch bei KFZ. Schließlich wurde dieser Effekt auch dort zuerst entdeckt. Will sagen: wo viele Autos fahren, passen alle Leute (Rad- wie Autofahrer und auch Fußgänger) entsprechend auch besser auf. Die Unfallrate pro Fahrzeug ist für gewöhnlich gerade da und gerade dann am höchsten, wo und wenn eher wenig los ist. Der typische schwere Fahrradunfall passiert daher gerade auch im Mischverkehr auf wenig befahrenen Landstraßen oder auf verkehrsarmen Erschließungsstraßen. Schwere Unfälle auf Hauptstrecken gibt es erst, wenn Radwege ins Spiel kommen.
Entschuldigung, aber Sie scheinen grad nicht in der Lage zu sein eine recht einfache Passage aus der Studie zu verstehen. Ist ja nicht schlimm, aber dann plustern Sie sich doch nicht so auf.
Schon Ihr erster Replikversuch gegenüber der völlig korrekten Aussage von Markus Luft bringt das Kunststück fertig in drei Absätzen drei falsche Behauptungen aufzustellen.
Nochmal, und um mal etwas Grund dranzubringen:
Markus Luft schrieb – in Übereinstimmung mit den Studienergebnissen – dass laut Studie Keinen Zusammenhang zwischen Kfz-Stärke und Rad-Unfalldichte festgestellt werden konnte.
Das steht ja nunmal wörtlich in der Studie drin, ich habe Ihnen nochmal weitere Zitate rausgesucht, die die Aussage untermauern und präzisieren.
Sie widersprachen und behaupten stattdessen:
„Natürlich entstehen trotzdem sehr viel mehr Konflikte an stärker belasteten Strecken – völlig unabhängig vom Radwegetyp.“ Das mag ja ihr persönlicher Glauben sein, vielleicht ist es auch der schon von Einstein hinreichend eingeordnete „gesunde Menschenverstand“, in der Studie steht jedenfalls das genaue Gegenteil. Wörtlich.
Ihr nächster Versuch:“Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke.“ lässt mich zweifeln, ob sie den Kommentar von Markus Luft wirklich GELESEN haben.
Selbstverständlich sagt die Aussage das aus, was sie aussagt, dass nämlich kein „belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs“ besteht.
Anschliessend werfen Sie jetzt noch Radverkehrsstärken ins Rennen, offensichtlich ohne im geringsten zu verstehen, dass das ein gänzlich anderes Thema ist. Es ging ausdrücklich um Kfz-Stärken.
Die Konversation macht mich langsam etwas ratlos.
Schlafen Sie mal drüber und lesen die entsprechenden Seiten der Studie noch mal ganz unverkrampft durch, dann dürfte sich die recht einfachen Zusammenhänge doch eigentlich erschliessen.
Ihre Idee:
„Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke.“
Führt Sie auf die falsche Fährte. Die Aussage sagt aus, dass kein Zusammenhant zwischen Kfz-Verkehrsstärke und Unfalldichte des Radverkehrs besteht. Auf keiner der untersuchten Anlagetypen.
Kleiner Tipp:
wenn die Autoren schreiben, dass „Bei keinem der Anlagentypen (…) ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs (besteht)“, dann meinen sie tatsächlich, dass bei keinem der Anlagentypen ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs besteht.
Das haben die Autoren auch nicht erfunden, sondern das ergibt sich aus den Daten.
Ich kann es auch noch mal kürzer versuchen:
Äpfel sind in den allermeisten Fällen tatsächlich Äpfel, uch wenn es sich für Sie sehr exotisch anhören mag.
Herr Krückmann, mir wird es sicher nicht gelingen, aus dem Wirrwarr, den Sie hier zusammentexten eine stringente und nachvollziehbare Logik zu entfalten, aber um Ihr Gleichnis aufzunehmen: Manchmal sind Äpfel auch einfach nur …. Pferdeäpfel.
Das was wortwörtlich in der Studie zu lesen ist, ist eben leider nicht genau das was sie darunter verstehen, sondern ein Zusammenhang, der einen gedanklichen Transfer erfordert von der Betrachtung der Unfalldichte in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke – mit oder ohne Radverkehrsanlagen. Anders formuliert behaupten Sie vereinfacht gesagt allen Ernstes dass die Unfalldichte genau so hoch ist, an einer Straße mit 10 Kfz/Tag verglichen mit einer Straße mit 10.000 Kfz/Tag – das ist sowohl mit Einsteinscher Logik als auch einfach mit Common Sense betrachtet natürlich purer Nonsens!
Ich wiederhole es gerne für Sie:
Bei der zitierten Fragestellung geht es NICHT um einen Unfalldichtevergleich der Radwege über alle Kfz-Verkehrsstärken hinweg, sondern darum, inwieweit sich die Radverkehrstypen bei vergleichbarer Verkehrsstärke in der gemessen Unfalldichte unterscheiden. Und diesbezüglich sind die Wissenschaftler der BASt eben offensichtlich zu keinem belastbaren Zusammenhang gekommen.
Zum Verständnis: Mit dieser zentralen Fragestellung möchte man in der Studie klären, welcher Radwegetyp für welche Verkehrsstärkenbelastung am besten geeignet ist. Verblüffender Weise schneiden aber sogar Schutzstreifen bei hohen Verkehrsstärken relativ gut ab, weswegen man eben nicht Radwege oder Radstreifen empfehlen kann als Ergebnis der Studie (immer den Status Quo vorausgesetzt nicht den Idealzustand).
„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a) kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen weist Verkehrsstärken zwischen 18 und 38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“
Wenn Sie dieses Zitat ernsthaft als Beleg für Ihre Sichtweise hernehmen, braucht man sich nicht mehr zu wundern, warum sie so oft zu falschen Schlüssen gelangen, denn hätten Sie die Grafik 7-9 wenigstens ansatzweise verinnerlicht, dann wäre ihnen ganz sicher aufgefallen, dass genau diese Radwege, die sie als Best Practice aufs Schild heben (mit Ausnahme von zwei Ausreißern) eben an den wenig belasteten Hauptstraßen liegen, nämlich um die 20.000 Kfz/Tag während die meisten Radwegen an Straßen mit im Schnitt um die 30.000 Kfz/Tag angelegt sind. (Nachzulesen im BASt-Bericht auf Seite 20 unter Kfz-Verkehrsstärken).
„Die meisten benutzungspflichtigen Radwege liegen in den Verkehrsstärkeklassen von 20-25.000 sowie von über 30.000 Kfz/Tag. Die nicht benutzungspflichtigen Radwege liegen eher in Straßen mit niedrigeren Kfz-Verkehrsstärken, einige Anlagen jedoch auch in Straßen mit über 30.000 Kfz/Tag.“
Das hat auch durchaus seinen Sinn, da man damals in Deutschland wie heute in den Niederlanden oder Dänemark der berechtigten Auffassung ist, dass hohe Kfz-Verkehrsstärken auch höhere Unfallrisiken bedeuten. Ich denke irgendwann fällt ihnen der Irrtum sicher auf und die polemisierende Rhetorik auch gegenüber anderen Bloglesern hier ist ihnen dann hoffentlich zumindestens ein wenig peinlich auch wenn Sie sicher nichts anderes im Schilde führen als die meisten anderen, die diesen Blog mit Freude und hin und wieder etwas Übermut lesen (Nicht umsonst heißt der Blog ja „it started with a fight“ ;)
„Das hat auch durchaus seinen Sinn, da man damals in Deutschland wie heute in den Niederlanden oder Dänemark der berechtigten Auffassung ist, dass hohe Kfz-Verkehrsstärken auch höhere Unfallrisiken bedeuten.“
Das stimmt so nicht. Hohe (KFZ-)Verkehrsstärken bedeuten sowohl in DE wie auch in NL oder DK erstmal nur, dass ein Radfahrer dann auch viele Autofahrer auf einmal aufzuhalten droht. Um die zur Verhinderung dieses Szenarios verkehrstechnisch erwünschte Trennung des Radverkehrs durchzusetzen, muss man aber heutzutage, wo mehr Radverkehr
politisch gewollt ist, und man Radfahrer deswegen nicht mehr als Störenfriede kurzerhand wegsperren darf, eine politisch korrekte Alternativbegründung heranziehen. Also postuliert man einfach eine erhöhte Unfallgefahr für den Radverkehr. Da diese selektive, weil angeblich ja nur auf Radfahrer beschränkte, erhöhte Unfallgefahr aber eigentlich nur durch geplante Vorsatztaten der Kraftfahrer denkbar ist (sonst wären ja auch die Kraftfahrer selbst, und vor allem auch Radwegfahrer davon ebenfalls betroffen!), bestätigen Politik und Behörden die Autofahrer aber mit ihrem Trick darin, dass sie erstens die Krone der mobilen Nahrungskette darstellen und dass es ihnen zweitens deswegen erlaubt sei, aus Ungelduld § 315c StGB-Straftaten zu begehen.
Die gegenwärtige Begründung für Infrastruktur basiert auf einer Lebenslüge, und als „fahrradfreundlich“ wird man mir diesen Ansatz niemals unterjubeln können.
Ich weiss nicht, ob Sie es nicht verstehen konnen, oder partout nicht verstehen wollen, aber ich gebe es an dieser Stelle auf mit Ihnen darüber zu diskutieren.
Sie sind ja nicht mal in der Lage einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Erklärungen dazu scheinen Ihnen dann auch noch „wirr“ zu sein, und wörtliche Schlussfolgerungen der Studienautoren halten Sie für falsch oder haben beschlossen diese gänzlich anders zu interpretieren, weils Ihnen grad mal nicht in den Kram passt.
Womöglich glauben Sie Ihren Unsinn auch noch?
Vielleicht lesen Sie sich den Beitrag von ‚Grossmutter‘ durch, wenn Sie meinen Ausführungen nicht folgen wollen/können, hilft Ihnen das vielleicht ein wenig weiter beim Verstännis von Statistiken.
EOD
@Grossmutter: Höhere Kfz-Verkehrsstärken bedeuten in Bezug auf Radverkehr praktisch immer höhere Unfallgefahr. An diesem höchst einfachen Fakt ist nicht zu rütteln – weltweit.
Was die Politik daraus macht, um widersprüchliche Ziele in der Außendarstellung in Einklang zu bringen haben Sie ganz gut beschrieben, aber das ändert eben nichts daran, dass die Zahlen aus der hier zitierten BASt-Studie insofern verzerrend sind und nicht gegen eine – sehr oft – wünschenswerte Trennung der Verkehrsarten spricht.
@Alfons Krückmann: Bei allem Respekt für Ihr Engagement in Sachen Radverkehr – hier liegen Sie einfach komplett daneben und ich wüsste nicht, warum man das auch so stehen lassen sollte!
Die Fragestellung ist sowas von klar und nachvollziehbar, dass ich mich ernsthaft fragen muss, wie man das derart falsch interpretieren kann wie Sie. Selbst Gespräche mit ausgewiesenen Laien können Ihr eigenartiges Missverständnis nicht reproduzieren…
„Höhere Kfz-Verkehrsstärken bedeuten in Bezug auf Radverkehr praktisch immer höhere Unfallgefahr. An diesem höchst einfachen Fakt ist nicht zu rütteln – weltweit.“
Bis alle im Stau stehen und kaum noch Gefahr ausstrahlen… ;-)
„Die Überlegungen enthalten eine, neben anderen, besonders gravierende Fehlannahme und zwar wird unterstellt, daß es einen Zusammenhang zwischen der KFZ-Verkehrsstärke zur Radverkehrsunfalldichte gäbe. Für diese Annahme gibt es aber keinen Grund. Das steht sogar in BASt V 184 explizit so drin. „Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.““
Kurz: Der Zusammenhang ist in der Studie durch diese Linien in der entspr Grafik als lineare Funktion dargestellt. Explizit.
Die Gründe für die Annahme dieses Zusammenhangs werden in der Studie selbst bis auf die 4. Kommastelle genau angeben (R^2).
Man muss sie nur lesen und verstehen können, was in der Tat nicht einfach ist.
Leider wird fehlendes Verständnis (normal bei tiefergehenden statistischen Problemen) allzuoft kaschiert und durch Polemik wettgemacht.
In der Studie selbst sind für die einzelnen Führungen die Bestimmtheitsmaße für den in Frage stehenden Zusammenhang angegeben (R^2).
Das Bestimmtheitsmaß (R^2) gibt an, bis zu welchem Anteil die abhängige Variable y (hier: Radunfälle) aus der unabhängigen Variablen x (hier: Radverkehrsführung nach Kfz-Verkehrsstärke) erklärt werden kann. R^2 reicht von 0 (kein Zusammenhang) bis 1 (100% Zusammenhang: direkte lineare Abhängigkeit).
Bei Radstreifen ist dieses Maß sehr klein, ca 1 %, also quasi 0. Bei Radwegen und Schutzstreifen geht es bis zu 33%. Demnach kann 1/3 des Anstiegs der Radunfälle auf dieser Führung durch die Kfz-Verkehrstärke erklärt werden. Die Frage ist jetzt: wie valide, wie belastbar ist diese Aussage.
„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“
Belastbar bedeutet in der Sprache der Statistik eine hohe Validität.
Dazu muss die Studie genügend n aufweisen, man muss die anderen bestimmenden Faktoren herausrechnen können, etc pp.
Zu bedenken ist, das die Radunfallhäufigkeit von vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel vom örtlichen Radverkehrsanteil (safety in numbers), von der Radverkehrsstärke auf dem untersuchten Abschnitt, von der je nach Art der Radverkehrsführung schwankenden Zusammensetzung des Radverkehrs nach Alter, oder von sonst. örtlichen Gegebenheiten des Radverkehrs, Zustand der Infrastruktur (Schlaglöcher, Wurzeln etc) u.v.a.m.
Anlage und Methodik der Studie spielen gerade bei der Validität eine große Rolle.
Da z.B. der jeweilige Radverkehrsanteil, Safety in Numbers, in der internationalen Verkehrswissenschaft als eine der herausragenden Faktoren für Radverkehrssicherheit anerkannt, nicht einmal als aufgenommene Größe in der Studie auftaucht, kann man ihn und andere Größen logo auch nicht herausrechnen und so die Kfz-Verkehrsstärke als Faktor statistisch isolieren.
Belastbarer Zusammenhang bedeutet zumeist ein Vertrauensniveau von 95% oder auch 99,5%,
Wenn diese Studie keinen belastbaren Zusammenhang nachweisen kann, kann man wirklich nicht sagen, dass es keinen Zusammenhang gäbe.
Da würde jeder Statistiker die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Um das für Nicht-Mathematiker einmal deutlich zu machen:
Ein Zeuge ist sich zu 85-90% sicher, den Täter gesehen zu haben.
Reicht natürlich zu Recht nicht für eine Verurteilung aus.
Der Aussage des Zeugen fehlt die Belastbarkeit, das macht sie aber nicht entlastend.
Aus dem Freispruch folgt nämlich nicht, dass der Zeuge eine Falschaussage gemacht hat und es also keinen Zusammenhang zwischen Tat und Angeklagten gab.
Der Zusammenhang konnte lediglich nicht ausreichend belastbar nachgewiesen werden.
@ Matthias Huber
„Warum Radwege in vergleichenden Studien meist schlecht abschneiden“
Das ist, genauer betrachtet, eine falsche Präokkupation. Radwege, als Sammelbegriff für geschützte Radinfra, schneiden auf der ganzen Welt am besten von allen Radverkehrsführungen ab. Sei es in Studien oder sei es in Realität. Unter inzwischen 100en oder gar 1000en Studien zu Radverkehrsfgührungen gibt es, soweit mir bekannt, gerade mal 2 dänische Studien aus der Frühzeit der dänischen Radverkehrsförderung, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen.
Die wirklich einzige Ausnahme bilden Studien aus Deutschland, dem weltweiten lead-market der Kfz-Industrie.
Die Überschrift müsste also richtigerweise heißen:
„Warum Radwege in vergleichenden Studien aus dem Umfeld der deutschen Kfz-Industrie meist schlecht abschneiden“
Diese Studien funktionieren mehr oder weniger nach dem gleichen Muster.
Der international verkehrswissenschaftlich längst zum Standard gehörende Zusammenhang von Radverkehrsanteil und Radverkehrssicherheit, Safety in Numbers, wird schlicht ignoriert.
Aufgrund dieses völlig unwissenschaftlichen Verharrens in einem Status Quo Ante erscheinen die Tabellen, die R-Quadrats etc dieser Studien wie Voodoo oder wie die Arbeit von Chemikern, die heute noch Eisen in Gold verwandeln wollen.
Diese Arbeiten, wie man sie von der UDV, der BASt, den Angenendts usw kennt, sind zwar vom reinen Handwerk her hie und da zu gebrauchen, wissenschaftlich aufgrund ihrer seit Jahrzehnten überholten Grundannahmen jedoch völlig ohne Wert.
Ihr Wert ist ein propagandistischer. Sie dienen auch als sog. „Nudging“ (in eine gewünschte Richtung stupsen) in die Radfahrer- und Verkehrsplanerszene hinein.
Und sie sollen natürlich Herrschaft absichern, wie es sich für wirtschaftsfinanzierte Forschung & Wissenschaft gehört.
Das Infrastrukturmonopol des Kfz wird von Grün bis Schwarz auch aufgrund solcher „Studien“ mit allen Mitteln verteidigt – da gibt es keine Parteien, da gibt es nur Deutsche.
Eine von guter geschützter Radinfra getragene Verkehrswende in deutschen Städten wie in Dänemark oder Niederlande, das finden immer noch alle Politiker fatal für den Kfz-Leadmarket Deutschland.
Ein Umdenken in der (Rad-)Verkehrspolitik zu zivilisatorischen Ansätzen wie in NL oder DK, wo man mit Mobilität für die Schwächsten („Stop Kindermoord“) und Radschulwegen („Sicherheitsindikatoren“) begonnen hat, das ist hier immer noch in weiter Ferne.
Selbst beim Radentscheid in Berlin, im Moment das vielversprechendste Radverkehrsprojekt in Deutschland, ist davon keine Rede.
„Sei es in Studien oder sei es in Realität.“
Wo ist da der Unterschied? Bzw. woher kennst du als Einzelperson die Realtität der Gesamtheit aller Radwege, wenn nicht aus „Studien“?
„Unter inzwischen 100en oder gar 1000en Studien zu Radverkehrsfgührungen gibt es, soweit mir bekannt, gerade mal 2 dänische Studien aus der Frühzeit der dänischen Radverkehrsförderung, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen.“
Wäre es möglich, wenigstens einige dieser Unzahl an Studien, die das Risiko von Mischverkehr und Separation im Vorher-Nachher-Modus verglichen haben, hier zu verlinken?
„Wäre es möglich, wenigstens einige dieser Unzahl an Studien, die das Risiko von Mischverkehr und Separation im Vorher-Nachher-Modus verglichen haben, hier zu verlinken?“
Das erinnert mich an Niklas Luhmann. Ein Soziologe und Philosoph, der, ausgehend von der Definition von Leben in der Biologie („Autopoiesis“), seine Systemtheorie entwickelt hat. Spannend und äußerst aktuell!
„Luhmann beobachtete, dass Kommunikation in sozialen Systemen ähnlich abläuft wie die Selbstreproduktion lebender Organismen.
Ähnlich wie diese nur Stoffe aus der Umwelt aufnehmen, die für ihre Selbstreproduktion relevant sind, nehmen auch Kommunikationssysteme in ihrer Umwelt nur das wahr, was zu ihrem „Thema passt“, was an den Sinn der bisherigen Kommunikation „anschlussfähig“ ist. [Da helfen auch Internet und Google nicht, denn was nicht „anschlussfähig“ ist, das macht keinen Sinn (= es kann nicht verarbeitet werden), oft gibt es dafür keinen Sinn (siehe etwa Höhlentiere ohne Augen).]
„Sinn“ ist für Luhmann ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität: In der unendlich komplexen Umwelt wird nach bestimmten Kriterien nur ein kleiner Teil herausgefiltert; die Grenze eines sozialen Systems markiert somit eine Komplexitätsdifferenz von außen nach innen.“ (Wiki)
Vorgestern wurde ich wieder auf eine Studie aufmerksam gemacht:
The Influence of Bike Lane Buffer Types on Perceived Comfort and Safety of Bicyclists and Potential Bicyclists
http://docs.trb.org/prp/15-3701.pdf
In dem Post „Evidenzbasierte Politik oder How and how not to become a Fahrradstadt.“ bespreche ich eine im Auftrag von TfL (Londoner Verkehrsbehörde) erstellte Metastudie.
„International Cycling Inrastructure Best Practice Study“
https://radverkehrhamburg.wordpress.com/2015/08/27/evidenzbasierte-politik-oder-how-and-how-not-to-become-a-fahrradstadt-zwei-beispiele/
Sehr aussagekräftig ist auch die Studie des New York City Department of Transport: „Protected Bicycle Lanes in NYC“
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2014-09-03-bicycle-path-data-analysis.pdf
Die UDV Studie Abbiegeunfälle (Münster mit seinen vielen Radwegen performt um mehr als das Doppelte besser wie die Vergleichsstädte)habe ich hier schon zitiert.
“Lessons from the Green Lanes
Evaluating Protected Bike Lanes in the U.S.”
http://ppms.otrec.us/media/project_files/NITC-RR-583_ProtectedLanes_FinalReportb.pdf
“Findings: Changes in Ridership
We found a measured increase in observed ridership on all facilities within one year of installation of the protected bike lanes, ranging from +21% to +171% (Figure ES-4).
The increases appear to be greater than overall increases in bicycle commuting in each city. Some of the increase in ridership at each facility likely came from new riders (i.e. riders who, absent the protected bike lane, would have travelled via a different mode or would not have taken the trip) and some from riders diverted from other nearby streets (i.e. riders who were attracted to the route because of the facility, but would have chosen to ride a bicycle for that trip regardless).”
streetsblog 2012
“Study: Protected Bike Lanes Reduce Injury Risk Up to 90 Percent”
http://usa.streetsblog.org/2012/10/22/study-protected-bike-lanes-reduce-injury-risk-up-to-90-percent/
Nicht fehlen darf in solch einer Aufzählung die Fleißarbeit von Tommi, veröffentlicht auf cyclechat (Irgendwann 2011 schätze ich. Und seitdem in USA und GB mit dem Niedergang der dortigen Kfz-Industrien das VC nicht mehr Staatsdoktrin ist und auch aus den Blogs nahezu spurlos verschwunden ist, seitdem ist wirklich jede Menge dazugekommen).
Die gibt es hier. (Um den Kommentar hier nicht ausufern zu lassen [Anm. des Blogbetreibers])
Ich habe in zweien kurz reingesehen: Eine Umfrage. Die andere betrachtet nicht die Sicherheit von Streifen allein, sondern kompletten Straßenumbau.
Beides für Risiko von Mischverkehr und Separation nicht brauchbar. Zweite Chance.
Habe für heute Abend Bier kaltgestellt und Chips nachgekauft. Das kann noch echt spannend werden, weil noch nicht feststeht, ob die Judäische Volksfront
oder die Volksfront von Judäa die Oberdeutungshoheit über die Heilslehre der höchsten aller Radfahrsicherheitsaspekte in Sachen Radweg vs. Radfahrstreifen vs. Schutzstreifen übernehmen.
Im Moment hat wohl die Judäische Volksfront einen kleinen Vorteil in puncto Theoretisch-konzeptuelles Vor-bzw. Nachdenken, während die Volksfront von Judäa eine deutlich höhere Chancenverwertung in Sachen sozialempirischer Aspekte der vergleichenden Lehre statistischer Signifikanz abweichender Faktoren im Hinblick auf gegenwindbedingte Skalierungsproblematiken des Ausklammerns externer Ausschlussprinzipien vorzuweisen hat.
Wir werden sehen.
Ach ja, und nicht vergessen:
Always Look on the Bright Side of Life!
Euer Atze
Solange das hier einigermaßen sachlich und ohne Beschimpfungen abläuft, wird weiter freigeschaltet. ;-)
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Kommentare wiederholen, nur die Ausgangsposts und Blogs ändern sich von Woche zu Woche. Man könnte das sicherlich automatisieren. Würde Vorstadt-Strizzi und co. viel Lebenszeit ersparen. :-D
Es gibt eine soweit ich sehe hier noch nicht genannte interessante Meta-Studie von Beth Thomas und Michelle Derobertis:
The safety of urban cycle tracks: A review of the literature
Article in Accident; analysis and prevention 52C:219-227 · January 2013
Impact Factor: 1.65 · DOI: 10.1016/j.aap.2012.12.017 · Source: PubMed
Aus dem Abstract:
„The review indicates that one-way cycle tracks are generally safer at intersections than two-way and that, when effective intersection treatments are employed, constructing cycle tracks on busy streets reduces collisions and injuries. The evidence also suggests that, when controlling for exposure and including all collision types, building one-way cycle tracks reduces injury severity even when such intersection treatments are not employed.“
Sprich: Selbst mit „unsicheren Kreuzungen“ können separate Radwege unter dem Strich sicherer sein, als gar nichts zu tun. Das deckt sich mit internationalen Radunfallvergleichen, wo Deutschland ja auch nicht so schlecht wegkommt, korrelierend mit vielen Radwegen hierzulande.
Thomas/Derobertis kritisieren an den bisherigen Studien, dass viele davon nicht die Entwicklung und Zunahme des Radverkehrs in ihre Statistiken einbeziehen, dass sie *nur* auf Kreuzungen schauen, ohne die Vorzüge auf gerader Strecke zu bewerten, und dass sie reine Unfallzahlen, nicht aber die Unfallschwere betrachten. Bekanntlich verlaufen Unfälle von Radfahrern ohne Autobeteiligung glimpflicher.
Die Studie ist nicht kostenfrei erhältlich, aber es gibt eine ältere Präsentation online:
http://www.dot.ca.gov/hq/LocalPrograms/bike/cbac/Cycle_Track_Lit_Review_Presentation_2003.pdf
sowie einen Tabellenauszug:
http://www.dot.ca.gov/hq/LocalPrograms/bike/cbac/Cycle_Track_Lit_Review_Table_Considerations_in_Interpreting_Study_Results.pdf
Noch ein Nachtrag: Wie voreingenommen, unausgewogen oder gar ignorant die Rezeption der internationalen Studien in Deutschland ist, kann man ganz unwissenschaftlich auch in der dt. Wikipedia nachlesen. Im Unterschied z. B. zur englischen Fassung unterschlägt sie Studien, die Positives am Radweg finden.
So steht da https://de.wikipedia.org/wiki/Radverkehrsanlage#Unterschiedliche_Positionen_zum_Radweg heute noch beispielweise:
„Untersuchungen, die allgemeingültig einen Sicherheitsgewinn durch die Anlage von Radverkehrsanlagen nachweisen und damit die Aussagen der Studien widerlegen, sind jedoch nicht bekannt.“
Diese Aussage wird selbstverständlich nicht mit einer Quelle belegt. Wie sollte man auch, denn schon der Blick auf die englischen Wiki-Seiten zeigt, dass entspr. Studien durchaus bekannt sind – man muss sie aber auch wahrnehmen wollen.
Als Mutter habe ich oft das Gefühl, dass in Blogs wie diesem hier vor allem die sportlichen Männer zwischen 25 und 45 Jahren unterwegs sind, die natürlich keine Probleme damit haben, auf der Fahrbahn zu fahren und sich freuen, wenn der (benutzungspflichtige) Radweg nicht benutzt werden kann. Wenn ich alleine unterwegs bin, fahre ich auch gerne auf der Fahrbahn, denn da komme ich zügig voran und kann gut andere Radfahrer überholen.
Bin ich mit den Kindern unterwegs, sieht die Sache ganz anders aus: Bei einer Geschwindigkeit von rund 15 km/h fühlt sich die Fahrbahn (und auch ein „Schutz“streifen) unsicher an. Warum? Ich habe den Eindruck, dass Autofahrer umso dichter überholen, je langsamer ich fahre. Offenbar werde ich als stehendes Hindernis wahrgenommen, und an parkenden Autos kann man (als Autofahrer) ja auch dicht vorbeifahren. Dass die Wahrscheinlichkeit eines Schlenkers des Radfahrers bei langsamerem Tempo viel größer ist, und dass auch die Kinder viel eher mal einen Schlenker fahren als geübtere Radfahrer, scheint vielen Autofahrern nicht bewusst zu sein.
Ich möchte daher alle Mitdiskutierenden bitten, sich mal ein Kind für eine Fahrradtour zu organisieren und sich mit Kind ins Abenteuer „Fahrbahnradeln“ und „Schutzstreifen“ zu wagen. Ich nehme an, dass sich die Perspektive hinsichtlich geschützter Radinfrastruktur dann zumindest etwas verschiebt.
Gerade für Familien ist die subjektive Sicherheit sehr wichtig. Wer sich nicht sicher fühlt, lässt sein Kind nicht im Straßenverkehr Fahrrad fahren, sondern kutschiert es lieber mit dem Auto durch die Gegend. Und so lernen die Kinder schon von Anfang an, dass das Auto DAS Verkehrsmittel ist und Fahrradfahren höchstens etwas, das man mal am Wochenende draußen im Grünen genießen kann.
Aus dem Projekt „Fahrradfahren mit Kind“ kann man übrigens ganz einfach eine Regel für jeden Verkehrsplaner machen:
Frage: Würde ich mein 9jähriges Kind/ Enkelkind/ Patenkind/ sonstiges Kind alleine auf der von mir geplanten Radinfrastruktur fahren lassen?
Frage mit „ja“ beantwortet: Radinfrastruktur ist gut
Frage mit „nein“ beantwortet: Bitte nachbessern
Kann ich zu absolut nachempfinden.
@Jule: Der ganz große Denkfehler ist in der Debatte, dass alle annehmen, dass man das Problem der vom Kfz-Verkehr ausgehenden Gefahren nicht auf Seite des Kfz-Verkehrs lösen müsste (was der Rechtslage in Dt. entspräche). Stattdessen gibt es absurde Stellvertreter-Debatten, in denen keine neuen Argumente auftauchen und jede Stimme sofort in ein binäres Feld eingeordnet wird und Grauschattierungen nicht vorkommen. Es kann nicht sein, dass der Radverkehr sich schützen müssen soll durch Radghettos, obwohl er nicht das Problem ist.
Den Begriff „geschützte Radinfrastruktur“ finde ich übrings eigenartig. Es ist ein Begriff, der impliziert, es sei nicht angebracht, nach der Sicherheit zu fragen bei der Infrastruktur. Wobei bei genauer Betrachtung ja der Begriff gar nicht vom Schutz von Radfahrer*innen spricht … Statt der begrifflichen Nebelkerze sollte man von baulichen getrennten straßenbegleitenden Radwegen sprechen.
„Den Begriff „geschützte Radinfrastruktur“ finde ich übrings eigenartig.“
Ist er auch.
Man spricht ja auch nicht von geschützter Fußgängerinfra.
Trotzdem bildet man Fußgängerghettos. Sind etwa die Fußgänger das Problem?
Vor Zügen wird man durch Schranken geschützt. Warum eigentlich? Müsste man das Problem nicht auf Seiten der Züge lösen? (was der Rechtslage in Dt. entspräche)
Es gehört zum Wesen von „Grenze“ bzw baulichen Schutz, dass es Definitionssache ist, welche Seite sie schützt bzw begrenzt.
Ich möchte das anhand eines Mathematiker-Witzes verdeutlichen.
Ein reicher texanischer Rinderbaron lobt 10 Mill $ für denjenigen aus, der ihm mit einigen Kilometern Draht und 12 Stangen das größte Areal einzäunt.
Der Ingenieur baut ihm einen soliden Zaun, der, abhängig von der Eignung des Untergrunds, annähernd die Form eines Zwölfecks hat.
Der Physiker baut mithilfe großartiger eigens entwickelter Messapparaturen ungeachtet des Untergrunds ein zwar sehr wackeliges, dafür aber perfektes Zwölfeck, er umzäunt also die maximal mögliche Fläche.
Doch dann erscheint der Mathematiker. Der durchdenkt kurz das Problem, nimmt die 12 Stangen in den Arm, wickelt den Draht um sich herum und postuliert: Ich bin außen.*
Der Begriff geschützte Radinfra ist doppelt gemoppelt, das stimmt. Es ist eigentlich schon dem Begriff Radinfrasruktur zu eigen, dass diese Infrastruktur soweit wie möglich bzw. soweit wie nötig vor Interferenzen mit Kfz- und Fussverkehr geschützt ist.
Geschützte Radinfrastruktur ist ein defensiver Begriff aus einem Autoland, in dem es wirrerweise ausgerechnet aus Sicherheitsgründen zum Standard gehören soll, dass der Radverkehr vom Kfz-Verkehr (Panzer-Verkehr)gemobbt und mit Gefahr für Leib und Leben bedroht wird.
Das sich viele unter diesen Voraussetzungen nur noch im Kfz – und selbst im Pkw ist die Fahrbahn vielen zu gefährlich, der Trend geht Richtung Panzer – in den Straßenverkehr trauen, ja, da mag manch einer eine Krokodilsträne verdrücken.
Man kann diese Krokodilstränen nicht immer von Freudentränen unterscheiden, denn wenn der Radverkehr sein Potential wg Fahrbahnzwang nicht ausschöpft, dann bleibt der Kfz-Umsatz hoch.
* Für Nicht-Mathematiker die Pointe:
Er hat die ganze Erde eingezäunt, nur sich selbst nicht: Eine Frage der Definition.
Ich bin Vater und verstehe diese Anregung sehr gut.
Die gesamte Diskussion in Deutschland zu Fahrbahnradeln und Separierung ist verzerrt und krumm.
Das Beseitigen von „Radwege“ beruht in vielen Städten auf die miserabelste Qualität dieser „Wege“ (de-facto Gehwege in rosa). Es mag sein, dass RELATIV zu diesen „Radwegen“ das Fahrbahnradeln sicherer ist. ECHT & GUTE Radwege sind aber AN MANCHEN STELLEN noch sicherer! VIEL sicherer. An anderen Stellen kann Fahrbahnradeln sicherer sein. Ortsabhängig.
Auch in NL bewegt man sich teils weg von abgetrennte Radwege, weil dort die Kapazität der Radwege nicht mehr ausreicht (~65% Modal Split). Einen ganz anderen Anlass also.
Diese ganze „Fahrbahnradeln vs. Separierung“ Diskussion hat schon quasi den gesamten ADFC lahmgelegt. Diese Diskussion ist sinnlos und führt zu nichts. Lediglich die Autolobby lacht sich kaputt!
Die ERA 2010 als Stand-der-Technik bietet eigentlich alle Antworten. Man braucht dazu aber Verkehrsplaner die Ahnung haben von was sie machen.
Wo sinnvoll und sicher, dort plant man Fahrbahnradeln. An anderen Stellen MUSS eine Separierung geplant werden – aber in Regelmaß! Also mit allen Konsequenzen (vorrangig das Beseitigen von Parkstreifen/Kfz-Fahrspuren).
Fazit: diese Diskussion braucht Struktur.
Ich bin Vater eines Zwillingspärchens, das am Sonntag 3 Jahre alt wird. Und ich für meinen Teil kann die Eltern nicht verstehen, die ihre Kinder unbedingt auf Radwege mit ihren leider zu gut bekannten Nachteilen schicken wollen. Sobald die Kleinen 8 geworden sind werde ich mit ihnen das Fahren dort trainieren, wo Fahrzeuge fahren sollen: auf der Fahrbahn.
Die angesprochenen Schlenker sind nämlich nichts im Vergleich zu der Gefahr, von Rechtsabbiegern abgeräumt werden. Vor allem, wenn es wirklich „geschützte“ Radinfrastruktur ist. Denn geschützt ist die viel zu oft vor den Blicken der Autofahrer, hinter Büschen oder parkenden Autos, oder einfach nur abgesetzt von der Fahrbahn. Im Längsverkehr gibt es kaum Unfälle, die allermeisten Autofahrer halten genug Sicherheitsabstand. Gerade bei sichtlich unerfahrenen Radfahrern. Beim Abbiegen dagegen knallt es viel zu oft. Kein Wunder, wer rechnet rechts von der Rechtsabbiegespur mit Fahrzeugverkehr.
Man muss auch nicht so tun, als ob jede Straße eine Hauptverkehrsstraße wäre. Die allermeisten Straßen sind doch ruhige Nebenstraßen! Natürlich würde ich meine Kinder nicht gerade auf der B27 (Theodor Heuss-Straße) durch Stuttgart fahren lassen. Auf der fahr ich ja nicht mal, seit dort Radstreifen aufgebracht wurden vor einigen Jahren. So sieht die „geschützte“ Radinfrastruktur nämlich aus: Radstreifen in der Dooring Zone, und gerade mit dem erlaubten Mindestmaß. Was erst zu dichtem Überholen führt, denn „der Radfahrer fährt ja auf seiner eigenen Spur“.
Jetzt kommen sicher wieder die Hinweise auf NL oder Kopenhagen. In NL dient, wie in Münster, die Separation nach Fahrzeugart, gerade dem besseren Verkehrsfluß für Autofahrer. In Kopenhagen: genau das Gleiche. Dort stehen Radfahrer im Stau.
„Im Längsverkehr gibt es kaum Unfälle“ – das ist doch eine Nullaussage. Fragt sich nur, warum die Staunachrichten immer von Bergungsarbeiten berichten. Nach dieser Argumentation dürfte es auf Autobahnen ja „kaum“ Unfälle geben (alle fahren in dieselbe Richtung und es gibt keinen Querverkehr). Irgendwie scheinen „Straßenfahrer“ immer nur geradeaus zu fahren.
Die Gefahr, von Rechtsabbiegern „abgeräumt“ zu werden, gibt es doch auf der Straße genauso. Linksabbiegen ist ebenfalls nicht ohne. Selbst Motorradfahrer werden immer wieder „übersehen“.
Auf einem „richtigen“ Radweg kann ich, ohne die Straße zu „berühren“ (und ohne die Ampel abwarten zu müssen), gefahrlos rechts abbiegen.
Jetzt war ich eine Woche lang weg ohne Internet, und die Diskussion ist ja mächtig weitergegangen. Daher jetzt erst die Antwort auf diesen Kommentar:
Offenbar können Sie mich nicht verstehen, dass ich mit Kindern lieber gemütlich auf einem Hochbordradweg fahre als auf der Fahrbahn. Vielleicht denken Sie ja in fünf Jahren anders darüber.
Wie ich schon schrieb, halte ich die Gefahr von Rechtsabbiegern für kleiner, wenn man langsamer unterwegs ist. Natürlich bringe ich meinen Kindern bei, dass unachtsame Autofahrer beim Abbiegen nicht aufpassen und reduziere so das Risiko, von einem Abbieger überfahren zu werden.
Trotzdem halte ich das Fahrbahnradeln für gefährlich. Sicherlich halten die meisten Autofahrer genügend Abstand. Aber auch wenn 1000 Autofahrer anständig überholen, so genügt doch der 1001., der zu dicht fährt, um einen Unfall zu verursachen. Und dabei meint der das bestimmt nicht mal so. Mal eben kurz aufs Handy geschaut oder einfach nicht nachgedacht, und schon passiert was.
Ich bin auch schon mit Kind im Kindersitz mit weniger als 50 cm Abstand überholt worden (bei zwei Autospuren pro Richtung – am fehlenden Platz lag es also nicht). Hätte das Kind sich in dem Moment nach links gelehnt, hätte ich nichts tun können, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ich konnte die Autofahrerin – eine Frau um die 50 – an der nächsten roten Ampel einholen und ansprechen, und ihr war überhaupt nicht bewusst, dass ihr Überholvorgang mein Kind und mich gefährdet hat, und dass es überhaupt ein Problem sein könnte, so dicht an Radfahrern vorbeizufahren.
Natürlich gibt es auch die „Erzieher“, die oft beim dichten Vorbeifahren noch hupen. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder von einem solchen Idioten vor Schreck den Lenker verreißen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Erzieher umso häufiger auftreten, wenn es einen nicht benutzungspflichtigen Radweg gibt und man ausreichend Abstand von den parkenden Autos hält.
Zu den Nebenstraßen: Leider ist es zumindest für uns nicht möglich, ausschließlich kleine Nebenstraßen zu nutzen. Hängt halt davon ab, wo genau man wohnt.
Mein Wunsch: Breite Radwege, auf denen auch das Überholen eines Fahrradanhängers bequem möglich ist, und die von den fahrenden Autos durch eine Barriere (also nicht nur Farbe) abgetrennt sind.
Mir ist aber klar, dass das so schnell nicht geschehen wird, denn dann müssten zwangsläufig Parkplätze wegfallen.
Fahren dann fast alle mit dem Rad, können ja die wenigen Autos diese Wege nutzen und die Radfahrer fahren auf den breiteren ehemaligen Autofahrbahnen ;-)
Danke Jule!
Es wird nie die absolut ultimative Sicherheit geben. Nie. Damit muss man leben.
Auch die hinter Gebüschen verlaufenden Radwege haben leider ihre Tücken an den Kreuzungen, weil man schlechter gesehen wird und dann überraschend auftaucht. Zwar ist ein 9-jhriges Kind nicht so schnell da, wie ein „Kampfradler“, es kann aber hinter parkenden Autos noch überraschender erscheinen.
Dann sind Schutzstreifen nichts erstrebenswertes, sondern nur Kompromisse auf Straßen, in denen in der Regel sonst keine Infrastruktur da wäre. Ein richtiger „Radfahrstreifen“ ist breiter und hat auch einen gewissen Puffer zu parkenden bzw. fahrenden Autos. Das würde ich nicht als geeignete Infrastruktur für 9 jährige Kinder ansehen. Wie weit soll das Nachbessern deiner Meinung nach gehen?
Nichts desto trotz würde ich – egal, wie die Radwege tatsächlich sind – mein neunjähriges Kind nicht unbedingt entlang einer vielbefahrenen Hauptstraße schicken. Da darf es ja auch den Fußweg noch benutzen. Sondern im Nebennetz. In Fahrradstraßen. Anwohnergassen. Parkanlagen. Es soll sich an Verkehr und Gefahren gewöhnen. Es soll dieses vorausschauende lernen.
„Das würde ich nicht als geeignete Infrastruktur für 9 jährige Kinder ansehen.“
Erstens: Wenn Kinder noch nicht voll fahrbahntauglich sind, dann sind sie auch weder schutzstreifen-, radfahrstreifen- noch radwegtauglich. Entweder man kann geradeausfahren, Geschwindigkeitsvektoren richtig einschätzen und die Verkehrsregeln zuverlässig anwenden – oder man kann das nicht. Der Radweg ist doch keine „Idiotenspur“ für Behinderte.
Zweitens: Die von Radwegaktivisten behauptete Gefährdung auf der Fahrbahn beruht auf der Unterstellung, dass wir Autofahrer aus Ungeduld zu gefährlichen Körperverletzungen an Radfahrern fähig wären. Das ist für sich schon ein „dicker Hund“, aber die von dir hier indirekt erhobene nochmals verschärfte Anschuldigung, ich würde sowas auch noch bei Kindern fertigbringen, ist ehrenrührig.
Hallo, nicht die Frage ob die Infrastruktur geeignet ist, ist die Frage, sondern ob die anderen Nutzer richtig drauf sind. Auch auf einer Autobahn kann ein Kind Rad fahren solange keine Kfz unterwegs sind.
Erstens: Kinder müssen erstmal lernen, voll fahrbahntauglich zu sein. Und das geht nicht auf dem Verkehrsübungsplatz.
Problematisch sind beim Radfahren nicht die Standardsituationen (geradeausfahren, Verkehrsregeln anwenden), sondern die unerwarteten Situationen. Ich kann mich noch so gut an die Verkehrsregeln halten – wenn irgendein Idiot im Auto sich nicht dran hält, dann ist das vor allem mein Problem als Radfahrerin.
Vieles habe ich durch eigene Erfahrung gelernt. Kinder mögen vielleicht wie Idioten oder Behinderte wirken, aber sie müssen Zeit und Gelegenheit zum Lernen haben, um auch komplexere Verkehrssituationen meistern zu können. Sichere (!) Radwege reduzieren die Komplexität des Verkehrs, das ist gerade für die Menschen wichtig, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Radfahren haben.
Zweitens: Die allermeisten Engüberholer denken wahrscheinlich gar nicht darüber nach, dass das, was sie tun, andere Menschen gefährdet. Schließlich „passt“ es ja. Wieso sollten sie das bei Kindern anders handhaben?
Ich habe auch weniger Angst, vorsätzlich „touchiert“ zu werden, sondern mehr Angst, dass jemand mich aus Unaufmerksamkeit über den Haufen fährt. Und wenn derjenige von hinten kommt, habe ich keine Chance zu reagieren.
@ MARTINTRIKER
Gibt es zu diesem Aspekt fundierte Übersichten, in den z. B. jemand die zeitgenössischen Quellen aus den Anfangszeiten des Radwegebaus in den Niederlanden ausgewertet hat?
@ FRANK TER VELD
Wenn es doch eine Diskussion wäre. Ich finde, dass es ein kollektives Behaaren auf ideologischen Standpunkten ist ohne jeglichen Fortschritt und ohne Verständnisfortschritt für die Gegenseite.
@ VORSTADT-STRIZZI
Aus gutem Grund fährt die Bahn auf eigene Trassen und nicht im Straßenraum und muss die Bahn alle Bahnübergänge sichern bzw. diese werden ersetzt durch Unterführungen z. B.
Das ist hoffentlich nicht dein Ernst …
Ansonsten kann ich deinen Ausführungen schlicht nicht folgen.
Der Link im Artikel bei „, sinkt die Unfallquote zum Teil deutlich unter die der deutschen, wo in den vergangenen zwanzig Jahren“ geht bei mir nicht.
zu 1)
Verstehe ich es richtig, dass der Autor real existierende Schutzstreifen mit hypothetisch vorhanden nach ERA vergleichen will? Er fordert nämlich nur bei baulich getrennten Radwegen, dass man dort ERA-konform Radwege betrachten solle.
Richtig ist sicherlich der Einwand, dass man die Führungsformen bei möglichst ähnlichen Rahmenbedingungen testen sollte. Richtig ist dabei natürlich auch, dass Kfz, die nicht da sind, auch nicht gefährden können. Aber so einfach ist es dann auch wieder nicht. Bei mehrspurigen Straßen sind ja vor allem die Kfz auf der rechten Spur interessant und es ist auch von Bedeutung, ob die Kfz frei rasen können oder Stop-and-Go im Schleichverkehr sich fortbewegen. Von einzelnen Fasern geht mehr Risiko eines schweren Unfalls aus als vom Kolonnen langsamer Fahrzeuge.
zu 3) Die Gleichsetzung von Bevorzugung der Fahrbahn mit Risikoaffinität ist aber auch eine unzulässige Verkürzung. Außerdem halte ich es für eine unzulässige Vereinfachung, dass Unsicherheitsempfinden der genannten Gruppen für statisch zu halten.
zu 4) Städte wie Dortmund bauen weiterhin Radwege und zwar weiterhin ohne taktile und visuelle Trennung vom Gehweg, weiterhin mit Blauklötzchen-Pflasterung und weiterhin auf langsame Radfahrer ausgerichtet und mit der Garantie regelmäßiger Konfliktsituationen. Aber auch bei Schutzstreifen und Radfahrstreifen hält man sich nicht wirklich an die Richtlinien. Faktischen werden viele Schutzstreifen da angelegt, wo die Straße mit Gullys versehen ist und wo die Schlaglöcher am Rande entstehen. Diese fiktiven Neubauten – von denen der Verf. spricht – sind die absolute Ausnahme.
zu Fazit) Wo sind die Berechnungen? Oder ist es doch nur die Vermutung, dass es so ein könnte?
Und E-Autos sind keine Lösung, sondern dienen nur der Unterdrückung aufkommender Zweifel, ob der eigene Lebensstil nicht vielleicht ein Problem darstellt.
Hatte sich ein Leerzeichen reingemogelt. Jetzt geht er.
„Fahrradhautpstadt-Münster ist ein gutes Beispiel für radkial ansteigende Autoverkehre bei 100% benutzungpflichtiger separierter Radinfrastruktur.“
Nicht nur in Münster muss man vorhandene Fahrradwege benutzen, sondern das ist in ganz Deutschland so.
Aber auch in Münster fehlen leider noch häufig die Hinweise auf die Benutzungspflicht der Radwege mittels der blauen Schilder und teilweise auch noch die Radwege selbst, sodass man manchmal sogar gezwungen ist, illegal auf dem Gehweg zu fahren! (Denn wo soll man schließlich hin? Fahrbahn wäre zu gefährlich, und auf den Radweg geht es halt nur, wenn auch einer da ist)
„Schwere Unfälle auf Hauptstrecken gibt es erst, wenn Radwege ins Spiel kommen.“
Hier werden Ursache und Wirkung verwechselt, was zu einem fatalen Ergebnis führt.
Tatsächlich ist es nämlich so:
Unfälle passieren besonders zahlreich auf viel befahrenen Straßen (klar, wo viel los ist und mehr Menschen sind, passiert auch mehr). Darum werden Radwege gebaut, um vor Unfällen zu schützen. Deshalb sollte man auch immer zur Sicherheit Radwege benutzen.
Gruß aus Münster
Ja, und eine Warnweste tragen und einen Helm und am besten ganz zu Hause bleiben,
MONSTERLAND-RADLER. Wo ist der Beleg dafür, dass mit einem Anstieg der Verkehrsteilnehmerzahl linear und proportional auch das Unfallrisiko steigt?
„Nicht nur in Münster muss man vorhandene Fahrradwege benutzen, sondern das ist in ganz Deutschland so.“
Seit 1998 falsch. Informiere Dich bitte.
Radwegebenutzungspflicht wurde allgemein abgeschafft, nur hat das Martin Schulze-Werners Totschlägerbande aus dem Ordnungsamt bisher nicht begriffen. Die stellen in völliger Mißachtung jeglicher Rechtstaatlichkeit immer noch todbringende Benutzungspflichten an blutgetränkten Dreckspisten wie an der Wolbecker Straße auf.
Leider habe ich den Prozess vor dem Verwaltungsgericht verloren, weil Richter Beckmann schlicht keinen Bock hatte, sich näher in die Materie einzuarbeiten und die Akte mit Verweis auf die Bestandskraft vom Tisch gefegt hat. Das Urteil ist aber ein derart lächerlicher Scheiß, dass ich gerne in Berufung gegangen wäre – was der ADFC aber nicht mitgetragen hat.
Jetzt schiebe ich im Einklang mit § 25 Abs. 2 StVO liebend gerne mein Fahrrad die Wolbecker hoch und behindere die Premiummenschen in ihren Coesfelder Bauernpanzern erst recht.
Und Du informierst Dich bitte einmal ordentlich zum Thema „Radwegebenutzungspflicht“, bevor Du auch nur irgendetwas anatzweise Positives über Münster äusserst. Münster ist ein von Verkehrschauvinisten kaputtgeplantes Provinzkaff, dass auf dem besten Wege ist, im Verkehr abzusaufen.
Der @Radverkehr hat eine kleine Umfrage gemacht. Überraschend ausgeglichen, dafür dass wohl in erster Linie sehr bewusste Radfahrer folgen.
Die 52 Leutew, die sich jede Woche bei Twitter und in Blogs die immer gleichen Gefechte liedern, wobei ich eher vermuten würde, dass es weniger sind …
[…] Dichtung und Wahrheit über Radwege […]
Und wie immer versandet die „Diskussion“ nachdem alle einmal ihre Meinung kund getan haben … :-D
Vielleicht weil hier auch unverrückbare Positionen aufeinander treffen. Da kommt man dann irgendwann nicht mehr weiter. Und sollte es dann auch gut sein lassen…
Ich frage mich, ob man das nicht mal durchbrechen kann …
Schwierig, wenn eine Seite hier nicht die ziemlich eindeutige Studienlage gegen Bordsteintodespisten anerkennen will und die Helen-Lovejoy-Keule rausholt.
Zudem haben wir hier in Deutschland ein erhebliches Aufklärungsproblem: Die eigentlich zuständigen Ordnungsämter und Polizeistellen sind in Sachen Radverkehr ungefähr so gute Ansprechpartner, wie die katholische Kirche bei der Empfängnisverhütung.
Schwierig, wenn die andere Seite einfach stumpf ihr „Hochboardradwege sind unsicher“-Mantra runterpredigt ohne auf die unterschiedlichen Kontextfaktoren zu achten, genau darum ging es doch im Artikel…
So, dass war das ganze nochmal in Miniform. :-) Alle stapfen einmal feste auf und keiner macht Vorschläge, wie man nun bessere Studien machen müsste, mit deren Kriterien vorher alle einverstanden sind … Wobei dann bestimmt hinterher diejenigen, denen das Ergebnis nicht passt, Gründe finden werden, warum die Ergebnisse doch nichts taugen. So wie es mit Schlichtung bei Stuttgart21 war …
Ich finde es toll, hier endlich auch mal andere Meinungen zum Thema Fahrbahnradeln und Radstreifen zu lesen!
Ich habe mein Leben lang in Münster gewohnt (bzw. ein Jahr unter der Woche in Holland gelebt), habe so gut wie alles mit dem Rad gemacht (auch kein eigenes Auto besessen, habe ich nicht gebraucht, bis ich nach Osnabrück gezogen bin und auch nie vermisst). Habe in 25 Jahren keinen Unfall und keine nennenswerte Auseinandersetzung mit Autofahrern gehabt, ich hatte nie das Gefühl zu dicht und zu schnell überholt zu werden, wurde nicht von Autofahrern geschnitten und bin auch mit Fußgängern nicht aneinander geraten. Ich bin einfach immer stress- und sorgenfrei überall hingeradelt.
Nun wohne ich seit anderthalb Jahren in Osnabrück. Das Radfahren ärgert mich jeden Tag aufs Neue. So sehr, dass ich begonnen habe Fahrradblogs zu lesen^^ Aber auch so sehr, dass ich bei schlechtem Wetter schon mit dem Auto zur Arbeit fahre und wenn ich besonders mies drauf bin den Wohnungsmarkt in Münster checke, erwägend ob es nicht mehr Sinn macht mit dem Auto nach Osnabrück zu pendeln (vergangenes Wochenende ausnahmsweise mal gemacht, entspanntester Arbeitsweg seit langem), dann könnte ich ja wenigstens am Wochenende und abends problemlos radeln. Ich erlebe hier wirklich JEDEN einzelnen Tag, wie Autofahrer mich viel zu dicht und schnell überholen, weiche Autotüren und auf dem Radweg parkenden Autos aus und habe keine Chance links abzubiegen aufgrund des schnellen motorisierten Verkehrs und fehlender indirekter Linksabbiegerkreuzungen. Mein absolutes Highlight hier war, als ein Autofahrer mich absichtlich fast angefahren hat und dann noch zu mir meinte „ich mach dich tot, Radfahrer“ (Anzeige ist bereits erstattet). Die Radverkehrsführung mit ihren fehlenden Radwegen, schmalen Radstreifen auf der Fahrbahn (zusätzlich oft in der dooring zone, oft zugeparkt, aber immer mit mindestens Tempo 50 fahrenden Pkw und vor Allem auch LKW direkt daneben), fehlenden indirekten Linksabbiegerführungen empfinde ich als absolute Katastrophe. Der kürzeste Weg zu meiner Arbeit ist 3,5 km lang. Aufgrund der Radführung am Wall und an der Lotter Straße für mich aber zu gefährlich. Nun fahre ich durch Innenstadt, die einzige Fahrradstraße Osnabrücks und eine Tempo 30 Zone: 5 beschissene km auf denen es dann trotzdem noch zu Stress mit Autofahrern kommt, weil man irgendwann zumindest Wall und Lotter Straße queren muss…Ich glaube, wäre ich nicht in Münster aufgewachsen, würde ich hier auch nicht auf die Idee kommen Rad zu fahren.
Hiermal Impressionen für die Nichtosnabrücker: Sieht so für euch etwa ein sicheres Kreuzungsdesign aus? http://www.noz-cdn.de/media/2014/12/19/osnabrueck-interview-im-modellbauladen-an-der-kre_full_11.jpg Der viel gelobte Radstreifen befindet sich ja direkt an der Straße, das sollte dann doch eigentlich super sein… Stattdessen rückt der Radweg dadurch noch viel mehr in den toten Winkel hinein, warum sonst starben hier so viele Radfahrer (auch bekannt als Osnabrücker Todeskreuzung)? Ich würde jedem auch mal empfehlen mit dem Auto an solchen Stellen zu fahren, die Sicht ist wirklich katastrophal. Das Bild zeigt auch nochmal gut die Nähe zum motorisierten Verkehr, insbesondere dem LKW in Streichelnähe, wer soll sich da ernsthaft sicher fühlen (und sein)?
Dieses Stück vom Wall gehört zu meinem tagtäglichen Arbeitsweg: http://www.noz.de/media/2015/06/24/os-kreuzung-hasemauer-vor-bauarbeiten_full.jpg
Rechts neben dem türkisen LKW (und von denen gibt es hier viele) befindet sich ein schmaler Radstreifen. In der Kurve schlägt der Anhänger des LKWs dann oft nochmal richtig schön aus und schneidet den Radstreifen Ist es etwa eine unbegründete Angst, dass das passieren könnte während ich dorther fahre?
Hier habe ich mal gesehen, wie ein Radfahrer auf nasser Straße ausgerutscht und natürlich auf die Autospur gefallen ist, auch so eine unbegründete Sorge von mir? http://blog.zeit.de/fahrrad/files/2013/04/IMG_21351.jpg
Was ist eigentlich, wenn Blaulicht anrückt und die Pkw schnell an den Straßenrand rücken müssen. Im Auto sitzend hätte es mir auch passieren können einen Radfahrer in der akuten Stressituation (man will und muss ja sehr schnell Platz machen) zu übersehen.
Auch grandios, zum Linksabbiegen und teilweise auch zum Geradeaus fahren muss man auf dem Wall mehrere Autospuren kreuzen, habe leider keine guten Fotos gefunden aber könnt ihr euch vorstellen hier mal eben über zwei Spuren zu fahren?: http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.noz.de%2Fmedia%2F2016%2F02%2F22%2Fverkehr-neumarkt-wall_201602221406_full.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.noz.de%2Flokales%2Fosnabrueck%2Fartikel%2F673100%2Fmehr-autos-auf-dem-neumarkt-kaum-weniger-auf-dem-wall&h=618&w=1098&tbnid=ytNGrJj9vkGrwM%3A&docid=pH9q0q_LZy0HSM&ei=D5_6Vob7CcO4PqvHjbgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1304&page=5&start=72&ndsp=17&ved=0ahUKEwjGvrTsmubLAhVDnA8KHatjAzcQrQMIkQIwTw
http://www.noz.de/media/2015/10/29/osnabrueck-rueckstau-am-wall-wegen-der-baustelle_20152015101029291746_full.jpg (auf dem letzteren Bild sieht man auch nochmal, wie der eh schon schmale Radstreifen grundlos immer wieder von Autofahrern gestreift wird, auch das vermittelt keine Sicherheit). Anscheinend sind hier ja viele ultraschnelle, risikobereite Radfahrer unterwegs, die das ohne Probleme schaffen, aber für den normalen Alltagsradler (geschweige denn Kinder und ältere Personen) ist das ein Ding der Unmöglichkeit. An der Natruper Straße muss man zwar nur eine Spur queren um in die Wachsbleiche oder zum Combi zu gelangen (leider kein Foto gefunden), trotz dessen gelingt mir das meist nicht, so dass ich ewig auf der für Radfahrer freigegebenen Busspur stehe. Eine indirekte Linksabbiegerkreuzung wie es sie in Münster überall gibt wäre mir da lieber.
Hier auch mal eine Straße mit Mischverkehr, davon gibt es in Münster auch einige, allerdings in eher weniger befahrenen Straßen und eher bei Tempo 30. Auf der viel befahrenen Lotter Straße hat man bei Tempo 50 als Radfahrer keine Chance, hier wird man ständig zu dicht überholt: http://www.noz.de/media/2013/09/12/am-wochenende-wird-die-lotter-strasse-fuer-fussgae_full.jpg Wenn man hier selbst mal mit dem Pkw langfährt kann es aber auch schon heikel werden, man habe mal einen Rentner auf dem Rad vor sich der dann ohne das anzuzeigen plötzlich absteigt und auf den Gehweg wechselt. Bei sehr langsamen Radfahrern ist selbst das rollende Auto noch sehr viel schneller unterwegs als der Radfahrer, da nützt dann auch Tempo 30 nichts wenn kein Platz ist zum Ausweichen.
Vergleichsweise mal ein paar Bilder aus Münster: Hauptverkehrsstraße Ring: http://static.panoramio.com/photos/original/55456427.jpg
Wenn man hier mit dem Auto unterwegs ist und rechts abbiegen möchte gibt es erstmal ne Art „Pufferzone“ zum Radweg, von dort aus sieht man dann gut ob sich Radfahrer nähern. Das Bild zeigt auch nochmal, dass es auch Hochboardradwege gibt, die nicht hinter einem Wall parkender Autos und Bäume geführt werden. Hier kann man ganz entspannt, schnell, ungestört mit dem Rad vorwärts kommen, auch Überholen ist kein Problem.
Hier eine eher wenig befahrene Tempo 30 Zone, kein Problem ohne Radweg, bin hier täglich geradelt und nie geschnitten worden: https://cb-immoconsult.de/wp-content/uploads/2014/11/DSC3859-300×200.jpg
Entspannt linksabbiegen in Münster: https://veloviel.files.wordpress.com/2013/05/muenster_infra_8.jpg
https://veloviel.wordpress.com/2013/05/23/fahrradhauptstadt-munster-iv-radinfrastruktur/
Übrigens finde ich auch das Autofahren in Münster sehr viel entspannter als in Osnabrück. Und trotzdem wäre ich dort nie auf die Idee gekommen Arbeit, Einkauf, Sport und co. Mit dem Auto zu erreichen. Warum auch? Mit dem Rad ist es ja auch kürzer (dank vieler für Autos gesperrter Straßen und der fehlenden Notwendigkeit Umwege wie in Osnabrück zu suchen), schneller (und das trotz indirektem Linksabbiegen) und vor allem total entspannt:)
Kräftige Abrechnung mit Osnabrück. Und ich kann dir nicht widersprechen.
Haben wir uns mal bei „Pro Rad“ kennengelernt? Warst du mit deinem Freund kurz nach dem Umzug da?
Ich war neulich in Osnabrück und war auch über so manches negativ überrascht (Radfahrstreifen, die schmaler sind als das Rad …), aber mein Hauptaugenmerk lag da nicht auf Radverkehr. Münster kenne ich auch nicht so gut. Aber gefallen hat mir es nach dem ersten Eindruck weder hier noch dort aus Radverkehrssicht, so dass es mich nicht in beide Städte zieht zum Rad fahren.
Dein Kommentar, ELENA, zeigt, wie ich finde das Hauptproblem: Der Radverkehr geht in die Defensive und keiner traut sich ans Problem.
Ja, genau, und leider hat sich meine Meinung zur Radverkehrsführung in Osnabrück seitdem nicht gebessert, im Gegenteil nach all den Begegnungen die ich so in den letzten Monaten hatte (siehe obriges Hightlight)…
Fantastisch, hier endlich mal die Sichtweise eines Normalradlers zu erfahren. Ich hoffe sehr, dass Frau Bauer deinen Beitrag liest. Sie ist nach meiner Erfahrung ja der Meinung, bei der Gefährdung der Osnabrücker Radfahrer durch die katastrophalen Radverkehrsanlagen handele es sich um einen nötigen Kompromiss. Eine einseitige Gefährdung der ungeschützten Radfahrer hat in meinen Augen mit einem Kompromiss jedoch gar nichts zu tun – vor allem dann nicht, wenn die Autofahrerseite weiterhin „wilde Sau“ spielen kann und darf. Daher kann ich die Osnabrücker Verkehrsplanung nicht ganz ernstnehmen.
Was würde es bringen, wenn Frau Bauer (Zitat: „Wer Rad fährt kann nur gewinnen: Freiheit, Fitness, Fun!“ Fährt die gute Dame eigentlich selbst mal über den Wall?) das liest? Die mehr als 1000 Meldungen aus der Radverkehrsumfrage haben sie ja auch n Scheiß interessiert…(vielleicht hat sie die auch einfach gar nicht gelesen)
Habe Anfang des Jahres mal nachgefragt, was eigentlich aus den Meldungen geworden ist die ja eigentlich bis Herbst letzten Jahres ausgewertet werden sollten, hier die Rückmeldung der Stadt:
bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Leider konnten die Arbeiten am Radverkehrsplan (die Auswertung der Online-Umfrage ist ja ein wichtiger Bestandteil von diesem) nicht fortgeführt werden, da Frau Bauer bereits seit längerer Zeit erkrankt ist. Sie wird voraussichtlich ab dem kommenden Montag wieder an ihrem Arbeitsplatz sein und die Arbeit am Radverkehrsplan wieder aufnehmen. Sie erhalten dann auch sicherlich eine Rückmeldung Ihre Fragen betreffend
Das war Anfang Februar, seitdem nichts… Absolut lächerlich!
-Indirektes Linksabbiegen ist immer möglich, egal ob Radweg, Streifen oder Misch. Aufstellfläche braucht man nicht.
-Radfahrstreifen müssen nach ERA 1,85m breit sein und zu Parkständen einen 50cm Sicherheitstrennstreifen. Bei Schutzstreifen ist das leider eine andere Sache. Man kann keinen 1m Streifen mit einem Premiumradweg vergleichen.
-Dass die Sichtbedingungen bei Radfahrstreifen schlechter sind als bei abgesetzten Radwegen stimmt nicht. Man muss den Seitenspiegel nutzen. Vor dem Abbiegen steht man beim Radstreifen parallel, bei abgesetzten Radwegen dann vielleicht 45°. Also im Toten Winkel oder Schulterblickbereich.
Bei unsignalisierten Kreuzungen werden Radfahrer vor dem Rechtsabbiegen auf Radfahrstreifen überholt, also sicher. Bei signalisierten Knoten fahren Radfahrer aber bei Rot an den wartenden Fahrzeugen vor und wenn die Ampel dann Grün wird, bevor die Radfahrer die vorgezogene Haltelinie oder das Vorlaufgrün nutzen können, sind sie gefährdet. Es wird vergessen nach Radfahrern zu schauen, aber ein Radfahrstreifen geht mehr ins Bewusstsein, weil er einfach sichtbarer ist. Weitergehend werden bei Rechtsabbiegestreifen die Radspur links des Rechtsabbiegestreifens gelegt, dann muss der Rechstabbieger einen aktiven Spurwechsel machen und kann das Absichern nicht mehr vergessen. In Kopenhagen gibt es auch Kombispuren für Rechtsabbieger und Radfahrer, die auch den aktiven Fahrstreifenwechsel verlangen.
Indirektes Linksabbiegen ist in Osnabrück nicht immer möglich, da könnte ich dir mehrere Kreuzungen zeigen an denen es nicht geht. Z.b. Auf der beschriebenen Natruper Straße zum Abbiegen in die Wachsbleiche, wenn man indirekt links abbiegen will muss man von der Busspur erstmal über die hohe Bordsteinkante auf den Bürgersteig fahren. Oder man muss am Wall schon zwei Spuren kreuzen um überhaupt geradeaus weiter fahren zu können (z.b. Kurz vor der Lotter Straße, vielleicht hat ja jemand Fotos). Und das mit den breiten Radstreifen (ja, es handelt sich hier z.b. Am Wall nicht um Schutzstreifen) erzähl mal einer der Stadt Osnabrück. In Münster gibt es übrigens auch Strecken mit einem breiten Radstreifen z.b. An der Hafenstr, da kann man zu zweit nebeneinander radeln. Überhaupt kein Problem. Aber solange Städte es anscheinend nicht schaffen, breite Radstreifen anzulegen inkl. Abstand zu parkenden Autos, sind Hochboardradwege für mich die sichere (da Abstand gewahrende, meiner Erfahrung nach seltener zugeparkt, zur Not absteigen und auf den Gehweg statt nach links unter den Lkw) Alternative.
Wenn Absteigen die einzige sichere Möglichkeit ist, ist gewaltig was schief gelaufen …
ich sagte „zur Not“, also im Falle das Falles, ist mir noch nie passiert… besser als nach links in die rasenden Autos auszuweichen…
Wenn man in Münster rechts abbiegen will fährt man aber erst ein Stück in die Straße hinein wie das Bild oben demonstriert. Von dort aus sieht man schon durch gucken durchs Fenster rechts ob sich ein Radfahrer nähert, man steht ja quasi so als wolle man eine Straße an einer t-gabelung kreuzen, kein toter Winkel mehr…
Das finde ich auch ultragruselig mit dem aktiven Spurwechsel, das geht doch bei Autos schon oft genug schief… Da ist es mir lieber wenn der Autofahrer vor dem Rechtsabbiegen die Geschwindigkeit reduziert, bei schlechter Sicht anhält (so lernt man es zumindest in Münsters Fahrschulen, dem Osnabrücker Autofahrer sind Vorfahrtsregelungen offenbar gänzlich unbekannt), als wenn er mit Tempo 50 plötzlich ruberzieht und mich dabei evtl. Übersieht / meine Geschwindigkeit und dara resultieren Abstsnd falsch einschätzt…Ich persönlich bin bei Spurwechseln mit dem Auto immer ubervorsichtig, sei es auf der Autobahn oder in der Stadt, bei „voller“ Geschwindigkeit einen Radstreifen kreuzen zu müssen finde ich unmöglich. Normalea Rechtsabbiegen gibt dem vorsichtigen Autofahrer zumindest die Chance sich korrekt zu verhalten, und dem vorsichtigen Radfahrer wie mir zur Not anzuhalten und in die Defensive zu gehen um Schlimmstes zu vermeiden. Das Problem am Mischverkehr umd fahrbahnradeln zeigt sich hieran wieder sehr deutlich: es ist etwas für den schnellen, risikobereiten Fahrer, nicht für den eher langsamen, risikoscheuen Radfahrer. Wenn Leute wie du auf der Fahrbahn wie Autos fahren möchtet, dann könnt ihr das ja gern tun, eine Benutzungspflicht müsste es ja meiner Meinung nach auch nicht geben) aber dann hört bitte auf damit allen anderen Radfahrern Windmühlen in den Weg zu bauen indem ihr Hochboardradwege (und wie man am Münster Beispiel sieht können die ja sehr „premium“ sein) so anprangert und Städten qie Osnabrück damit die Gelegenheit gibt sich mit ihren ach so sicheren radstreifen noch zu schmücken…
Das Problem ist, dass der Autoverkehr zu schnell ist … Bei Tempo 20 wäre das alles viel entspannter in der Stadt …
da gebe ich dir Recht, deswegen ist in Münster übrigens trotz Hochboardradwegen die Diskussion in Gange, ob Tempo 30 in der Innenstadt gelten soll… Aber selbst Tempo 20 ist noch deutlich über dem was viele (ältere) Radfahrer bringen (insbesondere auf leicht hügeligen / steigenden Straßen wie in Osnabrück z.B. Lotter Straße)…und ich möchte mich als Radfahrer auch nicht genötigt fühlen möglichst schnell zu fahren, nur damit ich mit den Autos mithalten kann…
Wäre ich Stadtbaumeister in einer Stadt und hätte die Kompetenzen wie die Stadtbaumeister in der Nachkriegszeit, würde ich städtischen Verkehr entschleunigen (auch zum Leidwesen älterer Herren auf Carbon-Rädern und mit Telekom-Trikot …) Da würde sich kein Autofahrer trauen, zu drängeln, wenn vor ihm jemand mit 15 km/h Rad fährt.
Und ich gehe davon aus, dass Pedelcs sich bald stark durchgesetzt haben, so dass die 10 km/h-Rentner kaum noch existieren und dann müssen die anderen halt warten. Der Schwächste bestimmt das Tempo.
Wenn wir davon ausgehen, dass E-Bikes sich bald komplett durchgesetzt haben, dann können wir auch davon ausgehen, dass es in ein paar Jahren nur noch selbstfahrende Autos gibt und sich dadurch alle (???) Probleme gelöst haben…
Ich glaube nichtmal, dass ich 10km/h fahre wenn ich eine steigende Straße hochfahre (wie hier den rund um die Rheiner Landstraße den Finkenhügel hinauf, geschweige denn sowas wie Knollstraße am Anfang, da muss man teils absteigen) und selbst auf weniger bergigen Strecken möchte ich auch gerne 5km/h fahren können ohne direkt überrollt zu werden (sei es weil ich nach ner Hausnummer suche, weil die Straße glatt ist oder weil ich aus der Puste bin).
In Pedelecs sehe ich keine TOP-Lösung. Ich beobachte die Entwicklung sehr kritisch.
Ihr müsst versuchen, die andere Seite zu verstehen. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist nun mal das ausschlagebende Kriterium für die meisten Radfahrer. Und damit muss man arbeiten. Das muss man berücksichtigen, wenn man mehr Radverkehr will. Man wird dieses Gefühl nicht von aussen abstellen können. Also muss man Wege bauen, die subjektives und objektives Sicherheitsgefühl in Einklang bringen.
An erster Stelle will gute Radfahrbedingungen nicht viele Radfahrer*innen. An zweiter Stelle will ich Verlagerungen vom MIV weg … Verlagerungen vom Fußverkehr zum Radverkehr finde ich kein Ziel.
Natürlich muss man das subjektive Empfinden ernst nehmen, aber auch das ist sehr wandelbar (so aus eigener Erfahrung). Aber am Ende ist die obj. Sicherheit, die hoch sein muss. Und das sollte sich dann it der subj. Sicherheit decken. Nur weil Leute sich sicher fühlen, wenn sie mit einer Knarre durch die Stadt laufen, werde ich das noch lange nicht befürworten, weil langfristig das Risiko für alle steigt …
Ich finde, dass Du da VIEL zu sehr auf ein Kriterium verkürzt.
Ausschlaggebend für die Wahl des Verkehrsmittels ist immer noch die Reisezeit. Das lässt sich auch in ‚Fahrradstädten‘ wie MS gut beobachten. Die Grenze des Verkehrsmittels ‚Fahrrad‘ verläuft ziemlich genau dort, wo das Auto beginnt einen Reisezeitvorteil gegenüber dem Fahrrad zu haben. Das ist in MS meist (mit Ausnahmen) bei ca. 4-6 KM der Fall – je nach Strecke. Bei verlangsamtem Radverkehr (real existierende Radwege) liegt dann auch bereits bei dieser geringen Entfernung die Grenze der Reisezeitbudgets (s. Knoflacher u.a.). Es geht dabei um ZEIT, nicht um Entfernung!
Natürlich ist auch die in der Biografie gespeicherte/erworbene Zeit-Entfernungsrelation relevant: wer immer nur auf langsamen Holperwegen mit dauerndem Abbremsen und vielen schlecht geschalteten Ampeln unterwegs ist (typische Münster-Sozialisation), der/die wird die Vorstellung befremdlich finden täglich 15 KM zur Arbeit mit dem Rad zu fahren. Wer noch die Erfahrung von schnellem Radverkehr hat wird (ggf. mit Pedelec oder s-pedelec), der weiss und ’spürt‘, dass das locker im Bereich des 45 Minuten Budgets liegt – jedenfalls wenn man die Benutzungpflicht nicht so ernst nimmt. Dort wo in den NL der Radverkehr beschleunigt wurde (Radschnellwege, Planfreiheit, gute Oberflächen, etc.) zeigt sich, dass unmittelbar auch längere Strecken gefahren werden, einfach weil sie ins Reisezeitbudget passen, und weil negative moderierende Variablen klein gehalten wurden.
Subjektive Unfall-Sicherheit, soziale Sicherheit, Wetter, Verkehrsmittel-‚tradition'(!), soziales ‚Milieu‘, Berge, etc, sind von Fall zu Fall die moderierenden Variablen, die zuätzlich in die Verkehrsmittelwahl einfliessen. Gewohnheit ist ein weiterer Faktor. Bekannt ist, dass bei Umzügen eine Orientierungsphase besteht, in der entschieden wird, welches Verkehrsmittel gewählt wird, ob ein Zweit oder Drittwagen gekauft wird, etc.
Vage bekannt ist auch, dass Geschlechtsunterschiede bei der Wichtigkeit der moderierenden Variablen bestehen (soziale Sicherheit, subjektive Unfall-Sicherheit scheinen bei Frauen tendenziell wichtiger zu sein, Wegeketten scheinen bei Frauen oft anders zu sein, etc.).
Vergleiche mal die NL-Rad-Unterführungen, die fast immer komplett freie Sicht und eine offene Gestaltung haben mit den deutschen ‚Angsträumen‘, die die Planer da regelmässig in die Landschaft setzen!
Mitunter werden von Frauen Radwege/Bürgerradwege gefordert, dann aber nicht 24/7 angenommen, weil sie streckenweise ‚hinter der dunklen Hecke‘ geführt sind oder im Dunkeln das schöne Grün erstaunlicherweise zum beängstigenden dunklen Niemandsland wird („im Dunkeln nehm ich dann immer das Auto, ist doch klar, …“)
Vielleicht ändert sich die Lage ja mal, wenn endlich mehr Frauen in die Verkehrsplanung gehen, und dabei die unterschiedlichen Bedarfe berücksichtigen (hoffentlich nicht NUR die der Kinder, sondern stattdessen AUCH die der Kinder). Und offentlich setzt sich irgendwann die Erkenntnis durch, dass sich überbordender Autoverkehr nicht und niemals durch Radverkehr in den Griff kriegen lässt, sondern durch Repressionen gegen den Autoverkehr-t.
Möglicherweise ist sogar die Einstellung zum Fetisch ‚Auto‘ entscheidender als die Geschlechterfrage?
Eine Einengung auf die eine Variable ‚Subjektive Sicherheit‘ it m.E. ein ziemlich falscher Weg, der das Potential des Radverkehrs soweit eindampft, dass für die meisten die Vorhaltenotwendigkeit eines Autos (ggf. Zweit/Drittwagens) weiter bestehen bleibt.
Die Reisezeit ist für mich Kriterium Nummer 1. Siehe Das eine Argument für den Radverkehr. Aber die muss man auch für „unsichere“ Radfahrer hinbekommen. Ein schmaler Schutz- oder Radfahrstreifen in der Dooring Zone ist nicht des Weisheit letzter Schluss. Und das vehicular cycling ist nur was für das eine Prozent. Also brauchen wir andere Lösungen. Radweglösungen.
Vor zwei, drei Jahren war ich auch noch für Fahrbahnnutzung. Weil es mir nichts ausmacht. Ich lebe es heute auch immer noch. Aber ich will auch alle anderen Gruppen – Kinder, Eltern, Rentner – aufs Fahrrad holen. Und das wird mit vehicular cycling nun mal nichts. Das muss man einfach erkennen. Daher suche ich nach anderen Lösungen.
Keine Sorge, Radverkehr wird bei mir komplex gedacht. Auch die Wahl des Rades als Verkehrsmittel würde ich auch immer auf eine Vielzahl an Aspekte zurückführen. Nur interessieren diese Zusammenhänge viele Leute nicht.
Zu deinen Ausführungen noch eine ergänzende Anmerkung: In der Mobilitätsforschung beobachtet man eine Angleichung des Mobilitätsverhaltens der Frauen an das der Männer, d. h. die Frauen holen bei der Autonutzung auf. Die Verkehrswende ist das ganz sicher nicht. Da aber Merkel noch lange an der Regierung sein wird, kommt auch die vielleicht noch plötzlich, wenn sie beim Abarbeiten von den Grünen an die CDU outgesourcter Kernforderungen angekommen ist …
Und was genau, ist jetzt schlimm daran, wenn Frauen nachts nicht den Radweg neben der Hecke nehmen wollen? Nachts um halb 4 nach dem Discobesuch ist die Situation auf der Straße ja auch eine andere. Natürlich kann ich als Radfahrer auf der Fahrbahn fahren, wenn keine oder auch nur kaum Autos unterwegs sind. Ich könnte auch sicher auf der Autobahn mit dem Rad vorwärts kommen, wenn dort keine Autos fahren würden. Und vielleicht kommt einem das nunmal alles zu unsicher vor und man entscheidet sich fürs Auto. Man muss doch immer die aktuellen Gegebenheiten abwägen und da erscheint der Radweg tagsüber aufgrund des starken Verkehrs eben sicherer als die Fahrbahn, nachts ohne Verkehr kann sich das dann auch mal umdrehen. Ich gehe auch nicht nachts im Park spazieren, sollen wir deswegen jetzt keine Parkanlagen mehr bauen und die Fußgänger lieber auf der Autobahn spazieren lassen? Und wer dann gerade nachts und insbesondere als Frau statt nem Bus/Zug das Auto nimmt, den kann ich auch wieder voll und ganz verstehen, kannst ja mal unter #imzugpassiert nachlesen, wenn dir da keine Gründe für einfallen.
p.s.:
Daniel, sieh Dir mal das niederländische Evaluationsinstrument „fietsbalans-2“ an. Da ist sehr schön alles vertreten, was zu berücksichtigen ist, wenn das Potential des Radverkehrs entfaltet werden soll. Nicht nur die gerade gehypte „subjektive Sicherheit“, die stets (in schlechter Ausführung) billig zu haben ist, sondern auch all das was richtig ins Geld geht, was aber in D genau aus diesem Grund meist völlig ausgeklammert wird.
Ohne jetzt nachzulesen: die subjektive Sicherheit ist doch eher mit hohen Kosten verbunden, weil sie eben nicht durch Farbe auf der Fahrbahn zu erreichen ist.
Alfons will glaub ich darauf hinaus, dass gewisse Kreise dafür plädieren, dass man dauerhaft damit leben soll, dass sich Leute angeblich sicher fühlen auf XS-Radwegen …
auf Deutsch was zum Nachlesen:
http://www.fahrradakademie.de/fahrradkonferenz/utrecht/2008-06-13-borgman-fietsbalans.pdf
Zum indirekten Linksabbiegen braucht man nur eine Fußgängerfurt, die quer zur vorherigen Richtung in die linksabgehende Straße führt. Bei T-Kreuzungen ist es dann aber sehr blöd, wenn es keine Aufstellfläche gibt. Müsste man mal ein bisschen den Bordstein absenken.
Man muss natürlich einen Radweg und Streifen gleicher Breite vergleichen.
Auf freier Strecke ist es egal, aber bei Grundstückszufahrten oder Einmündungen werden Radwege gefährlich. Meist gibt es ja Längsparkstände. Rechtsabbieger, Linksabbieger und herauskommende Autos sehen wenig und schauen auch gar nicht, weil selbst die Anwesenheit des Radweges so verborgen ist. Außerdem werden beim Einbiegen die Furten blockiert. Es gibt zudem Konflikte mit Fußgängern.
Die Neuanlage von guten Radwegen ist m. E. teurer als Streifen. Wenn sich eine Umverteilung des Straßenraumes ergibt, sind Streifen fast kostenlos. Falschparker sind wirklich nicht ungefährlich, aber das Parken auf Radwegen (z.B. über Grundstückszufahrten) ist auch nicht unmöglich und das Ausweichen über den Gehweg mit eingeschränkter Sicht auch nicht ohne (Geisterradler).
Auf innerörtlichen Hauptstraßen mit innerörtlichem Charakter(Bebauung, Grundstückszufahrten, Einmündungen) verbinden m. E. Radfahrstreifen nach ERA-Maß die Wünsche langsamer und schneller Radfahrer mit objektiver Sicherheit. Ansonsten sind (abgesetzte) Radwege vor Kreuzungen an die Fahrbahn heranzuführen.
-Bei Veloweichen hat der Radfahrer eine gute Chance nach rechts auszuweichen, bei abgesetzten Radwegen kann er aufgrund des senkrechteren Winkels eher nicht mehr ausweichen. Bei Veloweichen sind die Möglichkeiten sich bemerkbar zu machen natürlich besser. Der Radfahrer hat einen Rechtsabbieger neben oder vor sich im Blick.
-Bei einer Veloweiche stellt sich vor der Konfliktsituation eine Parallelfahrt ein, meist werden Radfahrer vorher auf dem Radfahrstreifen gut sichtbar überholt. Wenn der Rechtsabbieger hinter dem Radfahrer quert, muss er mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie der Radfahrer fahren. Bei einer normalen Furt wird der Rechtsabbieger immer langsamer, sodass der Radfahrer ggü. dem Rechtsabbieger aufholt, er kommt plötzlich von hinten. Der Rechtsabbieger kann die Geschwindigkeit des RF schwer einschätzen, der RF weiß nicht, ob er gesehen wurde.
-Eine abgesetzte Furt ist schön für Schulterblickfans, aber man muss sehr schnell sein, denn das Auto dreht sich ja auch beim Abbiegen, bei der Veloweiche ist viel Zeit. Man beobachtet die Radfahrer schon vor dem Beginn der Veloweiche. Bei normalen Furt wird man durch das Lenken und querende Fußgänger abgelenkt.
-Dass Veloweichen subjektiv unsicher sind, ist eig. gut, denn dann sind Alle vorsichtig.
-Durch den Fahrstreifenwechsel gibt es kein Vergessen mehr. Selbst wenn ein Radfahrer den schnelleren Autofahrer nie einholen würde, werden die Meisten trotzdem in den Spiegel schauen. Wenn man einen Radfahrer im Spiegel und mit dem Seitenspiegel nicht sieht, sind die Spiegel falsch eingestellt. Bei der normalen Furt gibt es nicht diesen Ursache-Tat Zusammenhang. Der Fahrstreifenwechsel bedingt automatisch das Absichern.
-Ich denke, dass Veloweichen nicht so lang sein sollten. Der Hintergedanke ist vielleicht, dass Rechtsabbieger so weit entfernt von der Kreuzung immer schneller als Radfahrer sind. Aber Veloweichen von nur 20m Länge bringen auch den Fahrstreifenwechsel, sind aber für RF subjektiv sicherer.
-Nach dem Toten Winkel von LKW vlt. mal googeln. (-:
Gilt Alles auch für Kombispuren.
– Mal ein bißchen den Bordstein absenken wäre schonmal n Anfang, auch dann muss ich aber vom rad absteigen oder soll ich auf den Fußweg fahren? Und wenn jetzt noch mehr Radfahrer dazu kämen dann allemann auf den Fußweg? Und dann schön zu Fuß die Fußgängerampel queren? Na klar, dann dauert das Linksabbiegen tatsächlich lange… Muss aber nicht sein bei sinnvoller Linksabbiegerführung für Radfahrer…
– Man muss einen Radweg und Streifen gleicherBreite vergleichen? Ja, richtig und du glaubst also, das wurde in den Studien gemacht? Genau darum geht es ja in dem Artikel, viele Unterschiede und Kontextfaktoren wurden nicht berücksichtigt (wer die Studien in Auftrag gibt und wer davon profitiert übrigens auch nicht), daraus wurde dann pauschal „Hochboardradwege sind unsicher“ gemacht und alle predigen das nach… Genauso nervt es mich, dass immer alle Hochboardradwege über einen Haufen geschmissen werden. Für viele hier scheint die Definition eines Hochboardradweges ja „hinter parkenden Autos verlaufend“zu sein. Das erste Fotos aus Münster vom Ring (http://static.panoramio.com/photos/original/55456427.jpg) zeigt ja eben, dass es auch anders geht und ist nun echt nicht gerade der Einzelfall… (übrigens gibt es am Ring trotzdem viele Rechtsabbiegerampeln, warum werden solche hier eigentlich nirgends als Sicherheitsmaßnahme erwähnt?) …Ich könnte dir auch ein prima Beispiel zeigen für gleich breite Radwege und Streifen an der gleichen Straße, leider besitze ich kein gutes Foto, aber an dieser oben schon genannten Stelle (http://www.noz.de/media/2015/06/24/os-kreuzung-hasemauer-vor-bauarbeiten_full.jpg) verläuft auf der anderen Straßenseite (rechter Straßenrand unter der Unterführung, neben dem weiß-blauen Transporter) ein kurzes Stück Hochboardradweg, Radweg und Streifen sind genau breit, aber durch den Boardstein dazwischen (keine Bäume, keine Parkplätze, einfach nur Bordstein, sprich die Definition eines Hochboardradwegs)ist der Abstand zu den vorbeifahrenden LKW und Pkw immer in Ordnung, es überquert dort auch niemand den Bordstein oder hält darauf…
– durch das Lenken und querende Fußgänger abgelenkt? Ich bitte dich…Wen das ablenkt der wird aber erst richtig Probleme bekommen, wenn er plötzlich einen Radstreifen queren muss um rechts abzubiegen und dabei bei viel höherer Geschwindigkeit noch durch andere Autos und das Lenken abgelenkt wird… Einen Schulterblick muss man dabei erst recht machen. Im Gegensatz zu Kreuzungsdesigns wie am Ring in Münster (erstes Foto), denn dort brauche ich ja nur einfach nach rechts gucken und nicht noch über die Schulter um die Radfahrer zu sehen…Stell dir doch mal einen Lkw an dieser Kreuzung und dessen toten Winkel vor (kann das mal jemand fotoshoppen) und dann im Vergleich gibts ja das schöne Foto der Todeskreuzung in Osnabrück bereits inklusive Lkw (http://www.noz-cdn.de/media/2014/12/19/osnabrueck-interview-im-modellbauladen-an-der-kre_full_11.jpg), du kannst ja nicht ernsthaft behaupten dass Radfahrer auf dem Streifen dort nicht im toten Winkel sind (wie die Todesfälle leider viel zu gut zeigen)…Der Lkw braucht auch nur dort an der Ampel zu halten und mal eben auf die Ampel zu achten, auf das Auto links neben ihm oder zu niesen und schwups ist rechts daneben schon ein neuer unsichtiger Radfahrer aufgetaucht der eben nicht vorher zu antizipieren war… Kreuzungsdesigns in den Niederlanden sind ja auch darum ähnlich aufgebaut, also um im rechten Winkel zu den Radfahrern zu warten, da gabs mal so ein schönes, euch bestimmt bekanntes Video…
– Für das indirekte Linksabbiegen wäre es ja so eine kleine Wartefläche, damit man dem nachfolgenden Verkehr nicht im Weg steht.
http://hamburg.adfc.de/fileadmin/_processed_/csm_20151004ud_IMG_0307_16x12_01_040f972019.jpg
Man sollte aber nur bei grünwerdender Ampel starten, weil die Linksabbieger nicht unbedingt mit einer 90° Wendung rechnen.
– Getrennte Ampelschaltung ist gewiss eine gute Sache, aber erste Bedingung ist eine ausreichend lange Rechtsabbiegespur, die meist nicht vorhanden ist. Dann könnte man zwar die Rechtsabbieger mit den Linksabbiegern gemeinsam freigeben, aber meistens wird die Freigabe der Hauptrichtung zwischen RF und Rechtsabbiegern aufgeteilt. Also längere Wartezeiten für Rf, Fußgänger und Rechtsabbieger. Bei 2 Rechtsabbiegespuren ist sie Pflicht, bei dem Bild gibt es bestimmt keine Fußgängerfurt.
– Auf diesen Bildern sehen wir den Toten Winkel, den wir beim Autofahren aber mit dem Schulterblick einsehen können. Bei LKW sind Abbiegesensoren oder Kameras trotzdem erstrebenswert, denn man muss die Spiegel auch nutzen. Aber bei Kastenwagen ist die Situation ja wieder Diese.
http://fs5.directupload.net/images/160331/dfkj5wh4.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160331/32l74d2w.jpg
Diese niederländischen Kreuzungen arbeiten ja auch mit diesen Furtabsetzungen wie auf dem 2. Bild. Wenn der LKW in die Kurve fährt, dreht sich ja der Tote Winkel so, dass der ganze Radweg im Toten Winkel liegt.
– Bei dem Radweg aus Münster kann man sich folgende Frage stellen: „Wann schaut der Rechtsabbiegern (der Fiesta) nach RF?“
a) im Annäherungsbereich an die Kreuzung (Ampel grün) oder eben vor dem Einlenken (Rot/Grün). Hier ist es sinnvoller die RVA fahrbahnangrenzend anzulegen, wegen Bilder oben.
b) wenn er vor der Furt ist. Dann ist der Schulterblick gefragt, Kastenwagenfahrer sehen hier also nichts mehr. Der Rechtsabbieger muss so langsam fahren, dass er schauen und noch bremsen kann. Den Vorteil sehe ich nicht.
Da die Erklärung mit schlechten Sichtbedingungen o. ä. mir nicht ausreicht, erkläre ich mir diese Unfälle, dass das Schauen vergessen. Also: „Wie „erinnere“ ich die Leute zu schauen?“ Da kann ich mir irgendwelche Furtabsetzungen überlegen; ist doch egal, die Leute müssen erstmal gucken! Dafür Fahrstreifenwechsel.
Bei Kreuzungen ohne Ampel ist es unmöglich abgesetzte Furten zu fordern. (außer bei Zweirichtungsradwegen, aber wer will schon so etwas?)
Bei Radwegen, die direkt an der Fahrbahn verlaufen, mit Bordstein getrennt (ich nenne sie fahrbahnangrenzende Radwege) ist die Sache natürlich besser. Sie sind eigentlich vergleichbar mit Radfahrstreifen. Ich sehe aber weiterhin eine größere optische Trennung, dadurch dass Radfahrer auf Gehwegniveau fahren, werden sie beim Autofahrer ausgeblendet. Das Problem ist auch da das Vergessen; in Kopenhagen hat man ja diese fahrbahnangrenzende Radwege, aber mit Kombispuren. Und da bei Kombispuren immer geschaut wird, ist es egal, ob man diese mit fahrbahnangrenzenden Radwegen oder Streifen füttert.
Die Überholabstände müssten bei gleicher Breite gleich sein, Parken kann man bei Bordsteinabsenkungen für Grundstückszufahrten. Ich sehe den Bordstein meist als überflüssig. Besser der Bordstein zu den Fußgängern.
Die Begründung für Kombispuren kann man auch folgend machen:
– Wenn man bedenkt, dass es im Mischverkehr funktioniert und bei RVA nicht, dann fragt sich worin der Unterschied besteht. Erstmal wird im MV immer hintereinander gefahren, nur zeitlich kurze Überholmanöver unterbrechen dies. Aber bei mehrstreifigen Straßen wird auch geschwindigkeitsabhängig sortiert, indem man nicht immer wieder zwischen langsamen Fahrzeugen nach rechts wechselt und dann zum Überholen ansetzt; z.B. auf der AB oder eben wenn einige Radfahrer verteilt auf der rechten Spur fahren. (Freie Fahrsteifenwahl innerorts) Wenn wir nun auf dem rechten Fahrstreifen einen Radfahrstreifen aufpinseln, bringt dies keinen großen Unterschied. Ich nenne es selbstenstehende Separation.
Möchte jetzt ein Autofahrer rechts abbiegen wird er sich frühzeitig auf den rechten Fahrstreifen zu den langsamen Fahrzeugen einsortieren. Dies ist also vergleichbar zu der Kombispur. Aus dieser Argumentation bin ich pro Separation und für Kombispuren, denn wenn diese funktionieren, können wir guten Gewissens unsere Städte mit RVA zukleistern und so mit der subjektiven Sicherheit den Radverkehrsanteil fördern.
– Mit den Fußgängern kann sich folgendes vorstellen: Die Ampel wird grün, der Fiesta fährt an die Radfurt, schaut auf den Radweg oder auch nicht und lässt die Fußgänger durch. Ein Radfahrer kommt und, wenn er erfahren ist, schon an die Bremse gehen. Denn wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Fiestafahrer nach dem letzten Fußgänger nochmal auf den RW schaut? Kann man vom Radfahrer immer erwarten hier zu bremsen, das ist doch kein zügiger Alltagsverkehr. Blickkontakt ist ja auch nicht möglich.
Oh, schon so spät geworden.
zu deinem dritten Punkt:
Das stimmt so absolut nicht. Der Lkw auf Bild 2 bieg ja zunächst rechts ein, fährt dann im rechten Winkel zum Radweg und der gesamte tote Winkel liegt außerhalb des Radwegs. Er muss hier nicht über seine Schulter schauen (Definition Schulterblick),sondern nur nach rechts, denn von da kommt ja der Radweg! Dreh doch mal mental den Lkw samt toter Winkel Illustration um fast 90 Grad im Uhrzeigersinn und schau dann wo sich der tote Winkel befindet (nämlich in etwa dort wo jetzt der Lkw steht)… Bild 1 hingegen, man stelle sich alleine mal vor der Lkw Fahrer steht an der Ampel, ist kurz abgelenkt Blickenwendung vom Radweg weg), biegt dann nach rechts und übersieht einen neuen Radfahrer der in der Zwischenzeit aufgetaucht ist und durch die Drehung im Uhrzeigersinn nun komplett im toten Winkel liegt…
und zum vierten:
– der Schulterblick ist eben nicht gefragt, natürlich muss das abbiegende Auto langsam einbiegen und dabei Fußgängern und Radfahrern Vofahrt gewähren, so wie es die Verkehrsregeln eben besagen (und was in Münser auch einwandfrei klappt), was heißt du siehst den Sinn darin nicht? Wäre es dir lieber wenn Autos mit Tempo 50 um die Ecke rauschen?
Wie erklärst du dir eigentlich, dass es an der Todeskreuzung in Osnabrück so viele Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern gab, wo die Führung doch deiner Ansicht nach optimal ist?
-zu der Kreuzung in Münster: Wieso sollte der Autofahrer, nach dem Rechts einbiegend vor der Rad- und Fußgängerquerung auf Fußgänger achten aber auf Radfahrer nicht? Er guckt nach rechts und nach links, was soll er da bitte übersehen? Bin diese Strecke übrigens über mehrere Jahre fast täglich gefahren und musste nie an dieser oder an irgendeiner vergleichbaren Stelle abbremsen für Autofahrer, gerade am Ring kommt man super schnell voran mit dem Rad. Was meinst du mit es gebe keine Fußgängerfurt?
– zu Punkt 1: wow eine 1-Mann Linksabbiegerspur, wie großzügig, die andere Radfahrer dann allemann auf den Bürgersteig…Wie auch immer, hier ist das indirekte Linksabbiegen ja möglich. Es gibt ja auch eine Extra Radspur zum überqueren. An der Natruper Str. hingegen muss man über die Fußgängerampel und Fußgängerverkehrsinsel fahren, sprich auch regelbrechend wenn man fährt und nicht schiebt, da die Fußgängerampel ja nicht für Radfahrer gilt, auf der anderen Straßenseite muss man dann erstmal wieder scharf links und dann rechts in die Straße in die man möchte…
Wahrgenommene Gefahren auf (schmalen) Radstreifen (es braucht nichtmal eine Kreuzung), was passiert wenn…?
– das Auto / der Lkw meinen Streifen (plötzlich) streift (weil er abgelenkt oder grundsätzlich unachtsam ist, Aggressionen auf Radfahrer hat oder einfach weil der Pkw auf der linken Spur zu weit rechts fährt bzw. ein breiter Lkw ist von dem Abstand zu halten ist)
– ein Krankenwagen kommt und die Autos schnell nach rechts ausweichen
– sich rechts neben mir eine Autotür öffnet und ich plötzlich ausweichen muss (sprich nach links)
– bzw. wenn ich einem Schlagloch, einem Ast oder einem Gullideckel ausweichen muss (sprich nach links)
– oder einem auf dem Radstreifen parkenden Auto
– ich auf der nassen / glatten Fahrbahn ausrutsche
… ich krache mit den Autos zusammen und gegen die habe ich keine Chance!
Im Gegensatz dazu auf dem Hochboard: es besteht keine Sorge, dass Autofahrer warum auch immer plötzlich den Radstreifen queren und im Falle eines Ausweichmanövers weiche ich nach rechts auf den Bürgersteig aus (im allerschlimmsten Fall würde das bedeuten mit einem Fußgänger zu kollidieren – was unwahrscheinlich ist, denn meist ist auf dem Bürgersteig ja deutlich weniger los als auf der Fahrbahn-, das Ganze würde also im Gegensatz zum Auto nicht tödlich enden)
Und zum Thema Kreuzung..Was passiert wenn
– „schnell“ fahrende Autos (Tempo 20+) plötzlich nach rechts ausscheren um zu parken oder im Falle der Veloweichen zum rechts Abbiegen und mich dabei übersehen (weil toter Winkel, siehe meine Erklärung oben)
Auch dann wieder, tötlich!
Zu dem Punkt Veloweiche habe ich auch das Gefühl, dass ihr die Fähigkeiten der Autofahrer über- und den Einfluss von Umweltfaktoren auf die Spurwechselfahrleistung unterschätzt. Man denke mal an schlechte Witterungsbedingungen (Schnee, Regen, Dunkelheit, beschlagene Scheiben), Transport (Ikearegal drin, Umzugskartons, Familienwagen bis oben hin mit Reisegepäck voll), Ablenkung (Kinder im Auto), Überforderung (da neu in der Stadt und die Verkehrsführung nicht kennend: man muss plötzlich nach rechts), Fahrer die so eigentlich gar nicht mehr fahren dürften (Alkohol, Medikamente oder auch Schlaganfall und co,: Aufmerksamkeitsdefizite, Gesichtsfeldstörungen und wer es nicht kennt bitte mal Neglect googeln)… Hier auch mal eine nette schon etwas ältere Statistik zu Berufskraftfahrern (S. 7; meiner Meinung nach müsste ja das Abitur eine Grundvorraussetzung für den Erwerb eines Führerscheins sein und dürften Lkw eigentlich nur von hochintelligenten Menschen gefahren werden, gut dass die bald selbstfahrend werden…): http://www.bag.bund.de/cae/servlet/contentblob/9960/publicationFile/609/Sonderber_Fahrpersonal.pdf
Möchtet ihr wirklich, dass diese Menschen unter diesen Bedingungen euren Radstreifen bei „voller Geschwindigkeit“ (Tempo 20+) queren um nach rechts abzubiegen (im Sinne einer Veloweiche?) Mir persönlich ist es da lieber, sie biegen langsam in die Kreuzung ein…Zum einen ist beim Abbiegen der tote Winkel bei Abstand zur Fahrbahn weniger gegeben (siehe oben), zum anderen sind die Fahrzeuge langsamer und zuletzt kann im Zweifelsfall immer noch ich abbremsen…
Genau deswegen bin ich kein Befürworter von schmalen Radstreifen auf der Fahrbahn. Nur sieht es auf Radwegen im Ruhrgebiet nicht besser aus. Da wird auch geparkt, Mülltonnen abgestellt, bei Baustellen einfach mal im gesperrt, Türen von Autos geöffnet, Polizeiautos hingestellt, Stadtautos hingestellt, zu Fuß gegangen, weil der Gehweg zu schmal ist und/oder die Abgrenzung nicht erkennbar ist, Baustellenschilder aufgestellt, Schnee nur als Gnadenakt als letztes geräumt, … und ohne zu gucken eingefahren in Einfahrten.
Die Fußgänger*innen zu gefährden ist keine Lösung, auch wenn es für dich nicht so schlimm scheint, und setzt voraus, dass es kaum Fußverkehr gibt, was ein Indiz dafür ist, dass in der Stadtplanung gewaltig was schieff gelaufen ist.
Was meint ihr eigentlich mit Veloweiche?
Nachtrag: Möchtet ihr mit diesen aggressiven Autobesitzern die Straße teilen? https://www.facebook.com/IloveOS/photos/a.254307437974838.60787.174396185965964/1060345277371046/?type=3&comment_id=1060790867326487&reply_comment_id=1060811943991046¬if_t=photo_reply¬if_id=1459587451555820
Für alle, die den Link nicht öffnen können: Zitate zu einem auf der Fahrbahn fahrenden Radler auf Facebook
Pallaske Yves „Mit dem Auto überholen und dann ausbremsen. Der fährt dann schon auf den Radweg“ Vanessa Petzold „Genau so würde ich es auch machen“
Dirk Schneider „Naja dann soll er sein Fahrrad schonmal weiß lackieren … Aber schuld sind ja immer die bösen Autofahrer“
Sascha Steindor „Umfahren und gut“
Veloweiche ist so wie ich das verstanden habe das hier: http://www.lz.de/lippe/lemgo/3142892_Spurwechsel-mit-Gewoehnungsfaktor.html
Jaja, die Hasepost…
Das ist natürlich ein click-bait-Beitrag, mit dem nicht mehr als eine hohle Diskussion provoziert werden soll. Und wie sie von der Hasepost selber zugeben, fehlt ihnen sowohl „der juristische Background“ als auch „das Verständnis“. Dass die Hasepost pro Auto schreibt, ist ja altbekannt…
die Noz aber leider auch viel zu oft :( Dass solche krassen Kommentare überhaupt geduldet werden (auch bei Noz-Artikel schon gelesen, Zitat „die sollen mal auf der Autobahn mit Kreide spielen“) geht dennoch zu weit… ich hab n Screenshot gemacht, den ich heute mal an die Polizei und Führerscheinstelle weiterleite in der Hoffnung, dass es irgendwas bewirkt…
Beid er NOZ ist es ausgeglichen. Die haben im Lokalen auch fleißige Radler. Da es aber nur noch auf Klicks ankommt, werden Themen wie der Neumarkt natürlich extrem ausgeschlachtet.
Halte mich mal mit dem Kommentar auf dem Laufenden, ob und was die Polizei sagt.
Ich möchte die Diskussion um konkrete RVA-Lösungen nicht stören, aber mir kommt es ein wenig so vor wie das (Link) sehr gut auf den Punkt gebrachte Phänomen den Fussgängerstreifens (aka Zebrastreifen):
http://blog.tagesanzeiger.ch/politblog/index.php/64824/disziplinierung-der-toelpelgeher/
Nicht die unterschiedlichen Versionen von RVA sind der Kern des Problems, sondern die mit einer umwelt- und menschengerechten Stadt prinzipiell unvereinbaren Autoverkehre!
Wer das ausklammert kommt m.E zu falschen Schlüssen.
Das (der inkompatible Autoverkehr) wird m.E. auch aus den konträren Beiträgen als gemeinsamer Nenner kenntlich.
Statt sich aber diesem Problem zu stellen und den völlig überbordenden MIV endlich mal als Problemursache ernstzunehmen, und wenigstens in Ansätzen über harte Repressionen des MIV zugunsten des Umweltverbundes nachzudenken landen die Diskussionen immer wieder bei dem m.E. völlig absuden Punkt, wie sich trotz immer weiter steigendem MIV möglichst Stress- und Unfallfrei Radfahren lässt.
Das erinnert mich ein wenig an dieses Cover aus den 70ern:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Supertramp_-_Crisis.jpg
Statt dann das recht gute Konzept der ‚dualen Infrastruktur‘ aufzunehmen, das ja im Grunde auch der 97er StVO-Novelle zugrunde liegt, und für den Radverkehr zu fordern, dass BEIDE Lösungen (gute Separation wo nötig/sinnvoll PLUS Mischverkehr auf der Fahrbahn) für den Radverkehr notwendig (!) sind, wird verkürzt aus der Perspektive der unverrückbaren Dominanz der Autos diskutiert und ohne Not ein „entweder oder“ statt eines „sowohl als auch“ diskutiert.
Was soll das bringen?
Klar sind für den Radverkehr auch Kompromisse nötig, aber doch nicht zugunsten der Bedarfe des MIV, sondern zugunsten der anderen zwei Verkehrsmittel des Umweltverbundes.
@Elena:
genau hier stösst die verkorkste Verkehrspolitik in Münster an ihre Grenzen: durch das autozentrierte ‚Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass‘ steigt in MS der MIV immer weiter an!
Im Ggs. zu den oft recht guten Fahrrad-KM-Leistungen in NL werden in MS in Mehrheit nur mickrige Entfernungen mit dem Rad zurückgelegt (10-14 Kmh Durchschnittsgeschwindigkeit), was in einer ‚Stadt der kurzen Wege‘ kein Problem wäre, was aber in MS die anhaltende Suburbanisierungswelle und den ‚Flächenfraß‘ noch deutlich verstärkt.
Da ich selbst in MS wohne und OS mit dem Rad ein wenig kenne, kann ich Deine Eindrücke gut nachvollziehen, aber wie erklärst Du dann den im glorreichen Münster radikal eskalierenden Autoverkehr?
Und: wäre diese Eskalation überhaupt möglich, wenn nicht der benutzungspflichtig separierte Rad-Kurzstreckenverkehr in dieser Form stattfinden würde?
Das Münster-Modell erhöht systematisch die MIV-Kapazität DURCH separierte Radwege!
Wieso ist ÖPNV und Fussverkehr in MS so randständig?
Das Münster-Modell forciert Zersiedelung, indem die Erreichbarkeitsradien für den MIV durch separierten Radverkehr ausgedehnt werden!
Das Münster-Modell schafft systematisch Flächen- und Geschwindigkeitskonkurrenz zwischen der Verkehrsträgern des Umweltverbundes und limitiert den Radverkehr auf Kurzdistanzen im Kernbereich, wodurch Flächen für den MIV freigeschaufelt werden.
Ist es bei den Problemlagen des 21.Jhd. noch sinnvoll eine Infrastruktur zu promoten, bei der ’subjektiv sicher‘ kurze Strecken mit dem Rad gefahren werden, während unterm Strich – ausserhalb der Kommunikation des Stadtmarketings, und ausserhalb der subjektiven Befindlichkeit – bei Berücksichtigung des Gesamtverkehrs der MIV einen immer größeren Anteil des Verkehrs ausmacht?
(Bei Deiner Einschätzung über die verkorkste Infrastruktur in OS stimme ich voll zu. Das ist ein klares ‚weder noch‘, aber auch in OS haben halt die Bedarfe des MIV noch absolute Priorität. Radverkehr ist ein ’nice to have‘ um den ‚echten Verkehr‘ zu entlasten. Mal sehn was in OS die Ergebnisse des runden Tisches bringen?)
Vom wachsenden MIV in Münster ist für mich subjektiv nichts zu spüren, von wachsender Bevölkerung insgesamt hingegen schon (Schlangen in Supermarkt, Fahrräder davor, Mietpreise…), denn anscheinend zieht es die Leute ja dort hin…
Du verlangst also, dass wir jetzt alle auf der Straße fahren, damit der MIV sich langsam daran gewöhnt und dadurch irgendwann sinkt? Tut mir Leid, aber so viel Aufopferungsbereitschaft geht für mich zu weit, dann kann ich mich auch gleich noch als Medikamententestkaninchen bereit stellen, damit irgendwann Krebs geheilt wird… Wie unsicher es ist, sich mit aggressiven Autofahrern (gegen die der Staat auf jeden Fall mal vorgehen sollte) das Pflaster zu teilen, zeigen ja die Facebookkommentare, die ich weiter oben zitiert habe… Tut mir Leid für so viel Egoismus, aber dann gehe ich liebe in die Defensive: sollen die sich auf der Straße gegenseitig tot fahren, wenn ich dann zumindest auf dem Radweg meine Ruhe habe…
Ja, so unterschiedlich können die Wahrnehmungen sein. Ich fahre recht oft auch mal weitere Wege (oberhalb 7KM) mit dem Rad, das wäre mir auf den benutzungspflichtigen Radwegelchen so gar nicht möglich. Meine wenigen Unfälle hatte ich dagegen ausschliesslich auf diesen benutzungspflichtigen Radwegen. Ich fahre auch seit langem Rad, ca. 3 Jahrzehnte mit 4.000-12.000 KM im Jahr. Mittlerweile wieder ganz ohne Auto/Motorrad lebend.
Die bislang einzigen Risiken beim Fahrbahnfahren waren 2x Bußgeld wegen Mißachtung der Benutzungspflicht und 1x fast totgefahren, weil ich in einem Moment der Unkonzentriertheit so dumm war auf einem dieser neuen „Schutzstreifen“ zu bleiben, statt vor einer Mittelinsel mit Schulterblick (VC-konform ;-)) auf die Fahrbahnmitte zu wechseln. Es wird allerdings immer schwieriger überhaupt noch überregionale Wege zu finden, die mit halbwegs befahrbarem Belag ausgestattet sind. Fast überall finde ich immer mehr neue miese benutzungspflichtige Holperwege, oder holprige Wirtschaftswege mit Umwegefaktor von 1,2 – 1,5 auf dem ‚Radwegenetz NRW‘, womöglich ‚Bürgerradwege‘ mit erlaubt/verminderten 20 cm Gesamtoberbau …
Aber mal davon ab:
Ich verstehe Deine Antwort nicht recht.
Ich schrieb doch ganz ausdrücklich von „dualer Infrastruktur“.
Könnte es sein, dass es ein moderner Reflex geworden ist all die, die nicht in Jubel ausbrechen, wenn es bald überall noch mehr miese Radwegelchen als einzige A zu B – Möglichkeit gibt, gleich mal ins Lager der „bösen VC’s“ zu schieben, welche ja noichts anderes im Sinn haben, als unsere Kinder zwischen die LKW’s hetzen wollen?
Oder liegt es daran, dass Du das Konzept der dualen Infrastruktur (Altutz u.a.) nicht kennst, und Dir nicht vorstellen kannst, dass es auch Positionen jenseits der dummen Polarisierung von „Alle auf allgegenwärtige Pflicht-Radwege“ vs. „Alle auf die Fahrbahn“ gibt?
Die Grundidee dabei: Radfahrende sind eine recht heterogene Gruppe mit verschiedenen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Bedarfen (soziale Sicherheit, durchs Grüne vs. schnellstmöglich, ruhig auch über Klinkerwege vs. auf jeden Fall Asphalt, weit weg von Autos vs. umwegfreie Wege, etc. etc.), so dass in vielen Fällen BEIDES gebraucht wird: separierte Radwege UND Fahren auf der regulären Fahrbahn.
(Alternativ könnte man für mehrere 100 Mrd. ein komplettes zweites möglichst planfreies Verkehrsnetz für Radfahrende aufbauen, was allerdings in den engen mitteleuropäischen Städten zu vielen Abrissen führen würde)
Also ein „duales“ ‚Sowohl als auch‘ statt eines ‚Entweder oder‘.Die Spannweite beim Radverkehr geht ja vom Fussgänger auf Rädern bis zu Auto-Ersatz-schnell-Pendlern. Von Kindern und klaprigen Senioren bis zum Profi-Lastenrad-Kurier.
Ich ‚verlange (?)‘ mitnichten, dass alle auf der Fahrbahn fahren müssen. Im Gegenteil. Kleinere Kinder müssen/dürfen das ja eh nicht, und selbst in den NL wird ein großer Teil des Radverkehrs (ca. 40% des Radverkehrsnetzes) auf der Fahrbahn abgewickelt.
Wo hast du dabei ein Problem?
Stört es Dich, wenn neben Dir (Du auf dem Radweg fahrend)jemand mit dem Rad auf der Fahrbahn schnell von A nach B fährt? Möchtest Du lieber von dem/der auf dem schmalen Radweg mit viel zu wenig Platz überholt werden? Oder möchtest Du den Radverkehr entschleunigen mit dem Resultat, dass bereits oberhalb von 4-5 KM n der Regel das Auto genommen wird?
Stört es Dich wenn Du dabei mit dem Auto fahrend aufgehalten wirst, wo doch ein Holperwegelchen da ist, den der dämliche Fahrbahn-Radfahrer gefälligst benutzen soll?
‚Radfahrende als ‚Versuchskaninchen‘ und lebende Poller?
Ich schrieb doch recht unmissverständlich davon, dass es m.E. dringend notwendig wäre den Autoverkehr einzudämmen.
Das geht bekanntermassen nicht gut über den Radverkehr, sondern das braucht stets zwingend Repressionen gegen den Autoverkehr. Autofreie Städte, Innenstadt-maut, Parkplatz-entzug, Reisezeitverlängerungen über Tempolimits, Fahrverbote (200 oder 300 Meter Umkreis um Kitas, Schulen, Krankenhäuser, etc.), Pendlerpauschale weg, Dienstwagenprivileg weg und systematische Auto-Umwegigkeit (Groningen), etc.
Die Idee mit Fahrbahnfahren den MIV grundlegend eindämmen zu können vertrete ich nicht. Gleichwohl halte ich es aber für einen gravierenden Kardinalfehler, wenn mittels Benutzungflicht und Fahrbahnverboten (Z.254) die breiten und komfortablen Fahrbahnen endgültig den Autos zum alleinigen Gebrauch (bzw. Missbrauch) überlassen werden.
Die Strassen müssen endlich wieder den Menschen gehören, statt den Autos! (Ausnahme Autobahn)
Und Ja: der Autoverkehr steigt in MS tatsächlich rapide an, auch wenn es sich für Dich ’subjektiv‘ nicht so anfühlen mag.
Selbst in NL steigt der Autoverkehr leider kontinuierlich an: wer nur auf separierten Radwegen fährt kriegt davon tatsächlich nicht so viel mit. Wer mit dem Auto fährt (ausserhalb der Rush-hour) kriegt davon auch nicht soviel mit.
Genau das sag ich ja. Autoerreichbarkeit wird gesichert durch separierten Radverkehr in den Kernbereichen, der auf den Flächen des Fussverkehrs errichtet wird.
Was die tollen Kreuzungen in Münster angeht, da bin ich nicht ganz Deiner Meinung. Solche Kreuzungen – wie im verlinkten Foto – sind ja durchaus als ‚MS-Standard‘ anzusehen:
http://www.wn.de/Muenster/1735032-Schwerer-Unfall-am-Hansaring-Lkw-erfasst-Radfahrerin-an-Kreuzung
Wenn Du das MS-Konzept gut findest (scheint wohl ein unabänderliches ‚must have‘ aller MS-‚Eingeborenen‘ zu sein): warum ist der Fussverkehr auf so schlechtem Niveau?
Viele Städte haben ein besseres Verhältnis von Umweltverbund vs. MIV – ganz ohne ‚Fahrradhauptstadt‘.
Mittlerweile sind in einigen MS-Stadtteilen doch flächendeckend die Fusswege entweder durch Radfahrende oder durch parkende Autos, oder durch VIEL zu schmale Wege wegen des dazwischen gequetschten Radwegelchens nicht mehr stressfrei benutzbar, bzw. immer öfter gar nicht mehr nutzbar. Ich sehe immer öfter doppelreihiges Auto-Parken auf den Fusswegen ggf. plus eine Reihe Fahrräder! Es gibt immer mehr Stellen, wo die Fahrbahn frei ist, das schmale Radwegelchen fast frei ist aber der Fussweg zu 100% zugeparkt ist – mit stillem Einverständnis des MS-CDU-Ordnungsamtes.
Aber die eingeborenen MS-Radfahrenden scheint das nicht die Bohne zu interessieren, wenn die Rollator-Omi ratlos zwischen geparktem Auto und geparktem Fahrrad auf die verbliebene 40cm-Fussweg-Lücke schaut. Bei gleicher PKW Dichte/Einwohner hat sich durch Nachverdichtung die Bevölkerungsdichte erhöht, was zu einer drastisch steigenden Auto/Fläche-Belastung geführt hat. Als ‚auch Fussgänger‘ nehme ich das sehr wohl auch subjektiv wahr.
Natürlich lässt sich dann sagen: da muss man mit dem Rad oder als Fussgänger halt entschleunigt unterwegs sein, auch mal anhalten und öfter mal Schrittempo fahren. Stimmt.
Das Resultat: alles oberhalb von 5 KM fällt nicht mehr ins Rad-Reisezeitbudget, und es wird dann mit dem Auto gefahren. Ohne die auf schmalsten Wegelchen zusammengequetschten Radfahrenden würde das längst nicht mehr funtionieren, und der Mittelstrecken-MIV hätte längst seine Grenze durch Dauerstau gefunden.
Konsequent werden in MS selbst 300-Meter-Strecken mit dem Rad gefahren. Macht das Sinn?
Als Folge der niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten wird
selbst bei den Innenstadtnahen Vororten wie Sprakel oder Nienberge, Häger, etc. fast immer das Auto genommen und fast nie das Fahrrad.
Wenn Du jetzt sagst, dass eine grundsätzliche Fahrbahnfreigabe da keine grundlegende Änderung brächte, stimme ich Dir voll zu. Das ist keine umfassende Lösung, aber einer der notwendigen kleinen Schritte, um den Umweltverbund zu attraktivieren und den MIV zu de-attraktivieren. Und es hat auch eine symbolische Bedeutung: es ist IMMER und ÜBERALL mit berechtigt Radfahrenden oder mit Skatern, Wanderern, Kutschen oder Kindern auf Fahrbahnen zu rechnen. Das kommt dann auch den RadwegebenutzerInnen zugute, denn die allgegenwärtige Praxis der einseitigen Zweirichtungswege führt ja nicht nur zu nächtlicher Unbenutzbarkeit, sondern auch zu stark erhöhter Unfallgefahr bei den dadurch stets und systematisch nötig werdenden Querungen. Gerade Kinder und Ältere schaffen das nur durch pures Glück, denn die Fähigkeit Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen ist noch nicht, oder nicht mehr vorhanden. Unverständlicherweise sind diese billigen Zweirichtungswege ausserorts ERA-Standard.
Kurzum:
Dass einige verbohrt-aggressive Autofahrer was gegen Fahrbahn-Radfahren haben kann ich verstehen, dass Radfahrende was dagegen haben geht für mich in Richtung Stockholm-Syndrom.
Dessenungeachtet braucht es oftmals (s.o.) duale Infrastruktur mit guten separierten RVA. Es gibt da – je nachdem – objektiv berechtigten oder subjektiven Bedarf, und es ist Aufgabe der Verkehrsplanung diese Bedarfe nicht nur in Sonntagsreden anzuerkennen, sondern diesen auf hohem Niveau real gerecht zu werden. Dann aber einheitlich und durchgängig auf den wichtigen A zu B Strecken, und nicht – real existierend – alle paar hundert Meter chaotisch wechselnd (Fahrbahn, Bordstein, ‚Schutz’streifen, nur direktes Linksabbiegen, nur indirektes Linksabbiegen, etc, etc.), und ohne Benutzungspflicht.
Der Nachteil: separierte Radinfrastruktur kostet richtig viel Geld, wenn sie vernünftig/brauchbar gemacht wird.
Münster-Murks dagegen ist bllig: man deklariert einfach ein Stück Fussweg als benutzungspflichtigen Radweg. Auch die neue Mode mal eben miese „Schutz“-Streifen oder miese „Radstreifen“ aufzumalen hat neben ‚billig‘ kaum Vorteile, aber viele Nachteile. Manchmal führt das sozusagen zum Schlechtesten aus beiden Welten.
Welche Folgen ein dummes „entweder-oder“ (statt dualer Infrastruktur) hat, lässt sich ja gegenwärtig beim Presseecho zum HH-Alsterradweg gut beobachten. Motto: die ‚Fahrbahnideologen‘ nehmen uns unsere Radwege weg, was in diesem Falle ja sogar näherungsweise stimmt. Da hätte erst die Fahrradstrasse fertig gebaut werden müssen, und NACH einer Evaluation/Bürgerbeteiligung ggf.(!) der Uferradweg zugunsten der Fussgänger geschlossen werden können, oder eben erhalten werden müssen.
Also zu den Rad“fern“wegen, welche die Vororte mit der Stadt verbinden sollen, kann ich wenig sagen, da ich immer in der Stadt gewohnt habe und auch nie wirklich Freunde in den etwas weiter abgelegenen Vororten (also nicht Gievenbeck, Roxel) hatte. Meine Schwester hat allerdings viele Klassenkameraden aus Albachten und ist die Strecke dorthin mehrmals wöchentlich mit dem Rad gefahren (10 km ein Weg). Beim Freizeitradeln im Sommer (bin da mehrfach die Woche kurze Touren zwischen 15 und 30 km gefahren) ist mir nichts Negatives aufgefallen. Mag gut sein, dass dieses Netz in Münster zu verbessern ist. Meine Kommentare beziehen sich allerdings auf die Stadt.
Gegen duale Infrastruktur habe ich auch nichts, wenn jeder entscheiden dürfte wo er gerne radeln möchte, wäre das doch ideal. Wer sich das zutraut (und das sind in der Regel ja die schnelleren Radfahrer) kann ja gerne auf der Fahrbahn fahren. Ich möchte auf einer viel befahrenen Straße (und erst recht nicht bei Tempo 50) aber nicht dazu gezwungen werden. Auch Tempo 30 in der Stadt finde ich eine super Sache. Auf Hauptverkehrsstraßen braucht es dann aber dennoch die zusätzliche Möglichkeit auf einem vernünftigen Radweg fahren zu können, denn auf viel befahrenen Straßen haben die Autofahrer ja kaum Möglichkeit dazu einen langsamen Radfahrer regelkonform) zu überholen, siehe unten.
Und ja, mich stören Radfahrer auf der Fahrbahn, wenn ich als Autofahrer unterwegs bin. Nicht weil sie langsam sind (wie schon gesagt, ich fände es auch im Auto viel entspannter wenn überall in der Stadt Tempo 30 wäre, wenn man aber schon im Rollen zu schnell ist auf einer Hauptverkehrsstraße, kann ich schon verstehen, warum Leute genervt sind), aber weil ich den Anspruch habe Abstand zu Radfahren zu halten, genau wie ich als Radfahrer will, dass Autofahrer Abstand zu mir halten. Für mich wäre es das absolute Grauen mit dem Auto durch eine Fußgängerzone zu müssen, wo sich überall in meinem toten Winkel Menschen befinden, ich hätte total Angst davor versehentlich jemanden anzufahren, da man nunmal nicht gleichzeitig in alle Richtung gucken kann. Nicht schlimm finde ich Radfahrer auf der Fahrbahn hingegen auf weniger befahrenen Nebenstraßen bei Tempo 30 (Beispiel Wilhelmstraße in Münster), da kann ich den Radfahrer ja ganz einfach regelkonform überholen. Am fürchterlichsten dagegen finde ich auch als Autofahrer schmale Radstreifen auf der Fahrbahn (wie hier am Wall oder an der Rheiner Landstraße), der Autofahrer wird hier von der Stadt gezwungen einen viel zu niedrigen Abstand zu den Radfahrern einzuhalten (ich versuche schon so weit wie möglich links zu fahren und auf der Rheiner Landstr. kann man ja bei keinem Gegenverkehr auch nach links ausweichen, aber wenn viel Gegenverkehr ist kann ich auch nicht komplett abbremsen, da fährt mir der Hintermann auch hinten drauf). Darauf folgen schmale, viel befahrene Straßen mit Radfahrern, die leider auch immer viel zu weit rechts fahren und den Autofahrern damit signalisieren man könne sie ja noch überholen („passt doch“, Beispiel Lotter Straße). Genau die Situation hatte ich heute im Auto (Lotter Straße, viele Radfahrer, fahren alle sehr weit rechts, Gegenverkehr, mehrere Autos hinter mir). Zwei Autofahrer hinter mir sind fast ausgerastet hinterm Steuer, weil ich die nicht überholt habe (weil regelkonform nicht möglich aufgrund des Gegenverkehrs; mein Tacho zeigte übrigens Tempo 12, dabei war es eben und die Radfahrer waren alles junge Leute, selbst wenn man hier eine Tempo 30 Begrenzung machen würde gibt es also noch einen enormen Unterscheid zwischen Radfahrern und Autos). Ich mag es auch nicht, wenn Radfahrer sich im toten Winkel neben einem herschlängeln (vgl. Albtraum Fußgängerzone, kann ich auch auf dem Fahhrad nicht verstehen wenn Leute das machen; beobachte hier täglich wie viele Radfahrer auf dem Streifen neben den Lkw an der Ampel fahren, da bleibe ich lieber dahinter; auf der Lotter Straße passierte das heute übrigens an zwei Ampeln auch). Zusammenfassend wäre es mir sowohl als Auto- wie auch als Radfahrer lieber, dass in Mischverkehrssituationen immer hinter und nie nebeneinander gefahren wird. Das heißt Radfahrer in die Mitte der Fahrbahn, so dass sowohl deutlich wird, dass Überholen nicht möglich ist (und somit auch der Autofahrer hinter mir das rafft, statt mir dicht und wild gestikulierend aufzufahren), als auch dass Radfahrer sich nicht neben Autos herschlängeln sollten. Die schmalen Radstreifen in Osnabrück, die von der Stadt so beworben werden (die werben hier tatsächlich damit, dass sie was für Radfahrer tun, weil sie die Radfahrer auf der Fahrbahn führen und nicht auf dem Hochboard), sind da die schlechteste Lösung. Und wo es keinen Radweg gibt, sollte grundsätzlich Tempo 30 sein (selbst dann ist der Geschwindigkeitsunterschied noch viel zu hoch, siehe oben).
Ich kenne keine Zahlen zu Fußgängern in Münster, habe jetzt nicht das Gefühl man könne oder würde da nicht zu Fuß gehen. In Osnabrück hingegen ist auch das zu Fuß gehen ein Graus (ihr merkt schon, ich finde sämtliche Art von Fortbewegung in Osnabrück furchtbar), vor Allem aufgrund extrem autofreundlicher Ampelschaltungen bei denen man innerhalb von 3sec den Wall passiert haben sollte und aufgrund der rasenden Autos in der Stadt, die auch für Fußgänger eine Zumutung für die Sicherheit, das Gehör und die Nase sind. In Münster fällt mir lediglich negativ auf, dass viele Radfahrer ihr Fahhrad auf dem Gehweg parken und dadurch Rollstuhlfahrer behindern (Dauerbrenner z.B. der Rewe in der Innenstadt), was durch mehr Fahrradständer (gerne auch durch Wegnahme von Parkplätzen) sicherlich zu verhindern wäre. Parkende Autos auf den Fußwegen sind mir nicht aufgefallen, und sicherlich nicht in der Masse existent, wie hier in Osnabrück Autofahrer die Radstreifen blockieren.
Ich sage auch nicht, dass alle Kreuzungen in Münster super sind. Bei der von dir verlinkten Kreuzung sehe ich das gleiche Problem wie bei der Kreuzung in Osnabrück mit dem toten Winke. Die Kreuzung welche ich gezeigt habe (gibt davon jedoch mehrere) ist ein Beispiel für einen meiner Meinung nach gelungenen Hochboardradweg, was ein Radstreifen so ja nie erreichen könnte. Der Vorteil des von dir gezeigten Radweges ist aber immer noch, dass auf der Strecke der Abstand zwischen Autos und Radlern gewährleistet wird (Autofahrer überfahren gerne Fahrbahnmarkierungen aber keine Boardsteine) und er dadurch zumindest beim Nebeneinander herfahren auf der Strecke sicherer ist (+ siehe andere gelistete Vorteile von Hochboardradwegen und mögliche Gefahren von Radstreifen in meinen anderen Posts).
Veloweiche:
https://www.google.de/maps/place/Lesser-Ury-Weg+(Berlin)/@52.513163,13.4252245,101m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47a851bd2d538505:0x5ddbcf9c0320c7b7
Ist eigentlich der falsche Begriff dafür.
Kombispur:
https://www.google.de/maps/place/Kopenhagen,+D%C3%A4nemark/@55.6523831,12.4890929,97m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4652533c5c803d23:0x4dd7edde69467b8
Radfahrstreifen:
Überholunfälle im Mischverkehr sind schon sehr unwahrscheinlich und sind dann meist Ursache von zu geringen Abstandes. Bei Radfahrstreifen fährt man aber noch in verschiedenen Fahrstreifen und der Abstand ist vorgeschrieben. Da ist ein Unfall zwischen sich überholenden Radfahrern wahrscheinlicher. Der Überholabstand ist dann die Sicherheit für unvorhergesehene Schlenker. Und ein Radfahrstreifen hat meistens bessere Oberfläche als Radwege. Mit dem Krankenwagen stimmt schon.
Gegen das Dooring ist der Sicherheitstrennstreifen Pflicht. Besser keinen Streifen als einen zu schmalen. Bei einem 1,85er Streifen mit 0,5m Sicherheitstrennstreifen hat ein 0,6m breiter Radfahrer 1,75m, die er sich rechts und links aufteilen kann.
Parkende Pkw auf dem Radstreifen sind schon ein Problem, aber gibt es auch bei Radwegen. Das Ausweichen über den Gehweg ist für die Fußgänger auch nicht ungefährlich, weil das parkende Auto die Sicht blockiert. Bei Premiumradwegen würde dann zwischen Gehweg und Radweg noch ein Bordstein sein.(Sturzgefahr) Aber auch da werden Fußgänger eher auf dem Radweg laufen als auf einem Radfahrstreifen. Das gilt auch für Geisterradler.
Ein weiterer Punkt bei Radfahrstreifen sind ein- und ausparkende PKW. Beim Ausparken dürfte ja nichts passieren, denn man arbeitet sich langsam aus der Lücke heraus und steht dann vielleicht schief in der Parkbucht und dem Sicherheitstrennstreifen. Und dann schaut man nach den Kfz und Radfahrern in Einem.
Beim Rückwärtseinparken fährt man zuerst auf den Radfahrstreifen (vergleichbar zur Veloweiche). Und dann ist der Radstreifen blockiert, bis man in der Lücke ist.
Ob die Geschwindigkeit eines Rechtsabbiegers gering ist, hängt vom Kurvenradius ab. Dieser muss aber das Rechtsabbiegen von LKW und Bussen gewährleisten. Zudem kann man vor und nach der „Rechtskurve“ ausholen.
Bei Furtlösung ist aber eher die Geschwindigkeit des Radfahrers entscheidend. Der Rechtsabbieger fährt also langsam um die Kurve. Der Radfahrer weiß nicht, ob er anhält, weil aufgrund der Eckausrundung jeder so langsam fährt. Bleibt er vor der Furt stehen ist es gut, fährt er aber 1m weiter, muss der Radfahrer seine 20 km/h abbremsen. Für 1m Strecke braucht man mit 3,6km/h (so langsam wird keiner sein)=1m/s 1Sekunde. Also die Reaktionszeit des Radfahrers.
Diese bis zu 20km/h werden dann die Aufprallverletzungen verursachen und die geringe Geschwindigkeit des Rechtsabbiegers reicht, um ihn schwer zu verletzen, wenn er unter das Fahrzeug gerät.
Wenn ein Auto einen Radfahrer auf einer Veloweiche seitlich rammen würde, weiß ich nicht, was dann passiert.
Bei einem Fahrstreifenwechsel ist der Lenkeinschlag ja sehr gering, dafür die Geschwindigkeit höher. Der Winkel ist flach, die Geschwindigkeitskomponente in Querrichtung gering. Die Zeit zum Reagieren also größer. Wenn also der Radfahrer auf der Veloweiche normal einem Meter Abstand zu den Autofahrern hat und ein Autofahrer (ohne Blinken) nach rechts rückt, hat der RF die Zeit, damit zu beginnen nach rechts zu lenken und zu bremsen, bis er Autofahrer den Meter nach rechts gerückt ist. Je breiter also die Radfahrerfurt, desto mehr Zeit hat der Radfahrer zu reagieren.
Damit es bei der Veloweiche gefährlich wird, müssen Radfahrer und Rechtsabbieger nebeneinander fahren.
1. Ist die Geschwindigkeit des Rechtsabbiegers höher, ist er gerade am Radfahrer vorbeigefahren. Also muss er ihn gesehen haben.
2. Ist die Geschwindigkeit des Rechtsabbiegers niedriger als die des RF, hat der Radfahrer den Rechtsabbieger gut im Blick (Es stellt sich hier die Frage, ob bei der Furtlösung oder Veloweiche häufiger geblinkt wird?) und es ist durch die geringere Geschwindigkeit sicherer. Der aktive Fahrstreifenwechsel bedingt dann den Schulterblick. (-:
3. Sind die Geschwindigkeiten der Beiden gleich und der Radfahrer fährt hinter dem Seitenfenster, müsste er doch im Seitenspiegel zu sehen sein. (Hier gilt es dann darauf zu achten, den Radfahrstreifen der Veloweiche nicht zu breit zu machen, damit der Tote Winkel kleiner ist.) Der Radfahrer sieht denn den seitlichen Blinker.
Fall 3 ist selten, Fall 1 tritt bei langen und kurzen und Fall 2 bei kurzen (bei Ampelstau) Veloweichen auf.
Mit dem Toten Winkel habe ich nicht so verstanden.
Wenn die Radstreifen aber nunmal zu schmal sind, dann gibt es diesen Überholabstand eben nicht. Auf den Radstreifen in Osnabrück wird mann immer mit nur wenigen Centimetern Abstand überholt, Lkw streifen die weiße Linie sogar, wenn sie mittig auf ihrer Spur fahren.
Das Problem ist, dass Städte wie Osnabrück sich mit ihren (nicht regelkonformen) Radstreifen sogar noch schmücken, denn die seien ja immerhin sicherer als Hochboardradwege. Wenn man schmale Radstreifen und Radwege miteinander vergleicht (könnte man ja hier am Wall machen), bin ich sicher, dass der Hochboardradweg weniger Gefahrenpotential birgt.
Ein Problem ist das Ausweichen auf den Gehweg sicherlich, aber es ist im Gegensatz zum Ausweichen auf die Straße eben für niemanden lebensgefährlich. Wenn du die Wahl hättest, links unter den Lkw oder rechts auf den Fußgänger, was würdest du wählen? Hoffen wir, dass es zu der Situation nicht kommt… Gerade an Hauptstraßen sind entlang des Fußwegs aber eher weniger Fußgänger unterwegs (es läuft ja z.B. kaum einer 5 km zur Arbeit), wann resultiert das Ausweichen also wohl eher in einer Kollision, nach links oder nach rechts? Natürlich gilt das nicht für die Innenstadt, dort sollten Radfahrer auf die (weniger befahrene) Straße und nicht auf den (viel begangenen) Fußweg ausweichen.
Geisterradler fahren auch gerne dort auf dem Gehweg wo es keinen Radweg oder nur einen zu schmalen Radstreifen gibt (und wieder: Lotter Straße und Wall, Osnabrück), irgendwie verständlich…
Was ist, wenn ein ortsfremder Autofahrer etwas spät feststellt, dass er rechts abbiegen muss und somit zügig auf die Veloweiche fährt? Er muss ja extrem schnell entscheiden und befindet sich dabei noch in voller Geschwindigkeit. Ist der Radfahrer dann gerade im toten Winkel, haut er ihn garantiert um und das nichtmal absichtlich. Würde er ganz normal abbiegen müssen, hat er hingegen die Gelegenheit vor dem Einbiegen nochmal (notfalls komplett) abzubremsen um sich zu vergewissern, dass keine Radfahrer kommen. In der gesamten Diskussion hier, habe ich oft den Eindruck, dass von Autofahrern verlangt wird (und anscheinend auch angenommen wird, so sicher wie sich einige hier auf Radstreifen und Veloweichen fühlen), dass diese extrem vorrausschauend und allumsichtig fahren. Natürlich sollen Autofahrer vorsichtig fahren, aber selbst der vorsichtigste Autofahrer hat halt nicht 10 Augen und gerade auch bei Ortsfremdheit werden viele Autofahrer mit solchen Situationen schnell überfordert sein.
Nochmal zum toten Winkel. Schau dir mal das Video an (z.B. bei 2:39 min), das zeigt ganz gut, was ich meine. Wenn der Autofahrer rechts abbiegt und dann immer noch Platz zum Radweg ist (lange Furt oder wie immer ihr das nennt; vielleicht könnte Daniel ja mal ein Radfahrer-ABC hier veröffentlichen, dann weiß jeder von was wann die Rede ist?), dann steht /fährt das Auto im rechten Winkel zum Radverkehr und somit liegt der tote Winkel nicht mehr auf dem Radweg.
[…] Nachstehend ein Link zu einem Artikel, in dem die Sicherheit von verschiedenen Radverkehrsanlagen betrachtet wird: http://itstartedwithafight.de/2016/03/20/gastbeitrag-dichtung-und-wahrheit-warum-radwege-in-vergleic… […]
Im Längsverkehr gibt es praktisch keine Unfälle? Falsch, auch dort kann man sterben… Und im Unterschied zu Kreuzungen, wo man sich vielleicht noch vorsichtig annähern kann, hat man auf der Fahrbahn wirklich null Einflussmöglichkeiten… Es muss auch endlich mal die die Situation von Radfahrern abseits von Kreuzungen betrachtet werden, wenn es um das (nicht nur subjektive) Sicherheitsgefühl geht…
Und genau das, macht die Radstreifen sowie komplett fehlenden Radwege in Osnabrück auf viel befahrenen Straßen so unsicher und unattraktiv…Übrigens: Auch aus Dortmund hörte ich letztens, dass mehrere Radfahrer dort bereits erlebt haben wie sie einen Seitenspiegel tatsächlich abbekommen haben…Eine Bekannte hat Gleiches aus OS berichtet.
http://www.dresden-fernsehen.de/Aktuelles/Artikel/1393057/16-jaehrige-Radfahrerin-bei-Unfall-getoetet/
[…] abhängigen Obergrenzen für den Einsatz der Schutzstreifen aufgrund von “Studien” der BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen, Bundesministerium Verkehr) […]
Die zeitliche Einordnung und der Sinn und Zweck der BASt-„Studie“ kamen etwas kurz.
Beim Blättern durch die PLAST 9 (HHer Richtline für die Planung von Stadtstraßen – Radverkehr) fiel mir diese Passage im Kapitel 1.2 auf:
„Die PLAST 9 orientiert sich an …..neueren Forschungsvorhaben vor allem der Bundesanstalt für Strassenwesen …“
Aus dem Gastbeitrag oben:
„Seit der Gesetzesnovelle der StVO im Jahr 1997 dürfen Radfahrstreifen auch in stärker belasteten Verkehrsbereichen angelegt werden.“
Bis Ende 2009 (diese dann noch wg Formfehlern verzögerte StVO-Änderung) war der Eindatz von Schutzstreifen begrenzt. Siehe dazu Gwiasda (Kompetenzzentrum Radverkehr), Die Präsentation zum Seminar „Neue Regelwerke für den Radverkehr“ vom März 2009.
Auf Seite 42 u. 43 werden die von der !!Kfz-Verkehrstärke!! begrenzten Einsatzmöglichkeiten der Schutzstreifen graphisch dargestellt.
http://www.kompetenzzentrum-radverkehr.de/fileadmin/redakteure/pdf/LGB-Regelwerke.pdf
Das Fahrradportal des BMVI zur StVO Novelle 2009:
„Die 46. StVO-Novelle und die Novelle der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift erweitert unter anderem die Einsatzbereiche von Radfahrstreifen, Schutzstreifen,..“
Die besprochene „Studie“ der BASt mit ihren schweren methodischen Mängeln und unzulässigen Schlussforderungen diente offensichtlich einer vorgeblich „wissenschaftlichen“ Absicherung der Gesetzesverschärfung gegen den Einsatz baulich geschützter Radinfrastruktur durch deren Ersatz von -streifen. Eine Auftragsarbeit, deren Ergebnis höchstwaqhrscheinlich genauso feststand, wie die NOx Messergebnisse bei Diesel-Kfz.
Die „Studien“ der BASt und auch der UDV werden nicht von ihren Autoren international veröffentlicht – ich habe trotz intensiven Suchens und (unbeantworteter) Nachfrage (bei der UDV) jedenfalls noch keine Veröffentlichung in einer anerkannten Fachzeitschrift gefunden.
Das verwundert nicht, denn:
Veröffentlichungen dort unterliegen einer Peer-Review (Prüfung von mehreren anerkannten Wissenschaftlern des jeweiligen Fachbereichs auf verwendete Theorien, Methodik, Durchführung, Ergebnisse, Zulässigkeit/Plausibilität der Schlussfolgerungen etc).
[…] >> Auch lesenswert in diesem Zusammenhang ist dieser Artikel hier. […]
[…] gebaut werden müssen (ausführliche Erläuterungen zu diesen Fehldeutungen finden sich z.B. hier und hier). Mit anderen Worten: Es gab für die Radaktivisten von früher keinen Grund, Radwege gut […]